DER SOUND DER JAHRE
Westdeutschlands Reise von Jazz und Schlager zu Krautrock und darüber hinaus – Ein Trip durch fünf Musikjahrzehnte
von Jan Reetze (halvmall 2024, ISBN 978-3-9822100-6-3)
Wer die Musikgeschichte Deutschlands über fünf Jahrzehnte darlegen will, braucht Volumen – mit 505 Leseseiten kommt das Buch folglich schwer daher. Allerdings sind es arithmetisch auch nur 100 Seiten pro Dekade.
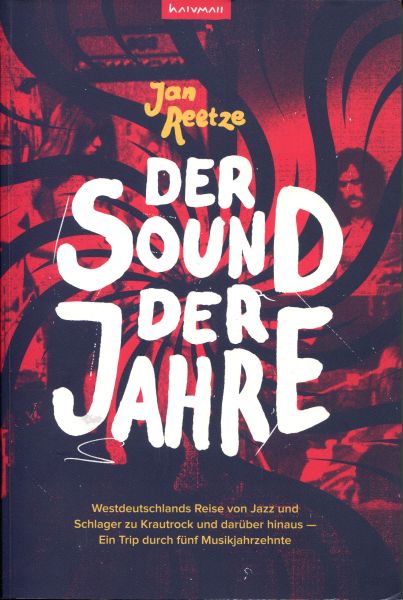 Man hat mir gesagt, dieses Buch sei ein Standardwerk. Das ist es nicht! Denn Volumen ist nicht alles, ein Buch muss auch inhaltlich fundiert sein. Das ist dieses leider oft nicht, doch dazu später. Was schon nach Lektüre der ersten Seiten auffällt ist, dass es Reetze an sprachlicher Eloquenz mangelt. Manches klingt doch recht steif, wie: „Neben all dieser Finsternis gab es aber auch ein paar freundlichere Aspekte: Mit den Alliierten änderte sich der Wind – zumindest in Westdeutschland. Eine Sache war im Zusammenhang mit dem Thema dieses Buches besonders wichtig: Die Alliierten reorganisierten den Rundfunk, und zwar gründlich.“ (S. 29) Und diese hölzerne Versprachlichung zieht sich durch das gesamte Buch.
Man hat mir gesagt, dieses Buch sei ein Standardwerk. Das ist es nicht! Denn Volumen ist nicht alles, ein Buch muss auch inhaltlich fundiert sein. Das ist dieses leider oft nicht, doch dazu später. Was schon nach Lektüre der ersten Seiten auffällt ist, dass es Reetze an sprachlicher Eloquenz mangelt. Manches klingt doch recht steif, wie: „Neben all dieser Finsternis gab es aber auch ein paar freundlichere Aspekte: Mit den Alliierten änderte sich der Wind – zumindest in Westdeutschland. Eine Sache war im Zusammenhang mit dem Thema dieses Buches besonders wichtig: Die Alliierten reorganisierten den Rundfunk, und zwar gründlich.“ (S. 29) Und diese hölzerne Versprachlichung zieht sich durch das gesamte Buch.
Die Lektüre ist ermüdend, denn Reetzes Buch ist wie eine Patchworkdecke – eine Ansammlung von bestimmt 100 eigenständigen Kapiteln, die zwar oft zeitlich zugeordnet, aber inhaltlich meistens nicht verknüpft sind. Es entsteht kein inhaltlicher Fluss, kein Faden, an dem man sich orientieren kann. Der Autor irrlichtert zwischen „Einsamen Cowboys, wartende Bräute“, „Das Leben als Telefonmusiker“, „Stockhausen“, „Übernachtung“, „Papas Kino, der kalte Krieg und das Wunder der Liebe“ oder „Hippies“, in dem er die Hippies sachlich falsch als Vorläufer der Gammler darstellt, und so weiter. Zu jedem Klops muss er ein Brötchen backen, z.B. zum „US-Radio“, obwohl das mit der BRD nichts zu tun hat. Und was soll der Rekurs auf politische Themen, wenn sie nicht als relevant für die musikalische Entwicklung gesetzt werden [siehe das Kapitel „Baader-Meinhof & Co.“ (S. 204ff), in dem sich Reetze allein auf zwei magere Zeitungsartikel von Wolfgang Kraushaar in Schweizer Zeitungen bezieht.] Natürlich schreibt er auch etwas zu Film und Fernsehen. Wenn Reetze seine Liebe zum Schauspieler Jacques Tati oder sein Faible für „Fluchtpunkt San Francisco“ erwähnt, dann kann er das so schreiben, oder?
Man muss Reetze einen guten Willen konstatieren, doch er hat, abgesehen von den 70er Jahren, zu wenig Wissen bezüglich der von ihm beschriebenen musikalischen Epochen. Hätte er sich allein auf Krautrock und die Neue Deutsche Welle, d.h. die deutsche Rockmusik der 70er Jahre, beschränkt, wäre ein gutes Buch entstanden. Dazu kann er sich sehr fundiert äußern. Und vieles dazu ist interessant und flüssig dargelegt, z. B. die Historie von Rolf-Ulrich Kaiser, dessen Verdienst es ist, The Mothers Of Invention, The Fugs und viele andere prägende Musiker nach Deutschland zu den 1. Essener Songtagen geholt zu haben. Auch seine „Krautrock“-Bandlandkarte ist gelungen.
Der Startpunkt für Reetzes Trip ist das Dritte Reich. Schon mit den ersten Kapiteln fällt dem Leser ein gravierender Mangel dieses Buches auf; es werden regelmäßig Ereignisse erwähnt und Behauptungen aufgestellt, ohne diese entsprechend zu belegen. Selbst wörtliche Zitate werden oft bzgl. ihrer Quelle nicht dokumentiert. Reetze schreibt im Vorwort über seinen Hintergrund als Wissenschaftler, aber wissenschaftlichen Standards genügt dieses Buch an vielen Stellen nicht, obwohl man eine Reihe von Fußnoten im Anhang findet.
Es gelingt dem Autor nicht, die Jazzszene der 50er hinreichend zu beschreiben: abfolgende Kapitel beschäftigen sich mit Doldingers (Düsseldorfer) Feetwarmers, Bert Kaempfert und „Telstar“ von The Tornados. Nach einem Kapitel über Peter Thomas („Raumpatrouille“), geht es dann um „Fluxus“ – der Kunstrichtung. Diese Kapitel kriege mal einer inhaltlich verknüpft!! Und wer sich musikalisch mit den genannten Namen auskennt, fasst sich gelegentlich an den Kopf! Zu Free Jazz hat er zu sagen: „Eine wichtige Sache, die von Hörern nicht verstanden wurde, war, dass diese Musiker Virtuosen auf ihren Instrumenten waren.“ (S.69)
Über den deutschen Schlager verbreitet er Oberflächliches, zum Teil Diskreditierendes. „Die Texte folgten den hauptsächlichen Zeittrends: Zunächst war das die Fresswelle, die Phase des übermäßigen Essens nach den Hungerjahren, die man nun glücklich überstanden hatte. Es folgte die Reisewelle…“ (S.35). Das ist inhaltlicher Müll! Die Lektüre von Prof. Volker Ladenthins Buch „Restauration und Rebellion“ kann man Reetze in diesem Zusammenhang nur empfehlen. Es würde seinen Horizont erweitern, nicht nur bezüglich der deutschen Schlagermusik.
Seine Aussagen über das Denken und Fühlen der Menschen in den 50ern und 60ern sind z. T. hanebüchen, auch rekurriert er immer wieder verallgemeinernd auf die Einstellungen und Ansichten in seiner Familie. Nicht jeder Familienvater trank zu viel Alkohol und verweigerte sich der Auseinandersetzung mit dem 3. Reich. Und wie das Prinzip Musikbox in den Kneipen funktionierte, weiß er auch nicht.
Wenn Reetze über die Musikszene in Deutschland in den 60er Jahren schreibt, dann hat er kaum Boden unter den Füßen! „Später entstanden bessere Möglichkeiten, in Deutschland live zu spielen, aber in diesen frühen Jahren war für junge Bands nichts anderes vorhanden als solche Jazzclubs, Bars und Cafés, manchmal Galerien.“ (S. 82) Er weiß nicht, dass die 60er Jahre die Dekade war, in der es die weitaus meisten Bands in der BRD und die bei weitem (!!) meisten Auftrittsmöglichkeiten für eben diese gab. Nie hat es mehr Profi- und Amateurbands in Deutschland gegeben, als in den 60ern, nie mehr Gaststätten, Clubs usw., die dann ab 1968 in dem einen oder anderen Fall zu Discos umgewandelt wurden oder für immer schlossen. Für Reetze gab es allein den Star-Club (und, Smiley, weil er von Helmut Wenske gehört hat, die Jolly Bar in Hanau!). Auch zum Star-Club tischt er nur das Übliche auf, siehe „Bär von Kerl“ (S.83). Bei Bear Family sind bestimmt 60 CDs mit deutscher Beatmusik erschienen. Hätte er deren üppige Linernotes oder die ca. 40 Bücher zur deutschen Beatszene gelesen, u.a. ein grundlegendes Werk von fast 500 Seiten, wäre ihm vielleicht klar geworden, dass er auf einem schwachen Bein steht.
Er jazzt die Star-Club News zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die „Hochglanzmagazine“ Bravo und Musikparade hoch (S. 89) – die Star-Club News war nicht nur recht einseitig ausgerichtet (als Promotion für den Star-Club), vielleicht ein bisschen weniger oberflächlich bei den Texten, aber auch dünner und vernachlässigbar in der Auflage. Politisch, wie er behauptet, war sie nicht (S. 89). Dann konstatiert er, dass die Platten auf Star-Club Records sich im siebenstelligen Bereich verkauft hätten (S. 90). Das kann er nur als Summe aller Star-Club Records-Veröffentlichungen meinen, denn glaubt er wirklich, dass mehr als 500 Menschen an Kalles „Ich bin ein Deutscher“ interessiert waren? Ich habe ca. 80 % meiner Star-Club-Platten aus den Ramschkisten gefischt, die LP 5,- DM, die Single -,50 oder 1,- DM. Wer hätte freiwillig für eine Crickets-Show-Band-Single, The Rivets „Now Decide“ 4,- DM bezahlt, oder für eine Lee-Curtis-LP den vollen Preis!? Es gab ein paar Veröffentlichungen, die gingen ganz gut (The Rattles, The Pretty Things, The Walker Brothers und Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich – die der letzteren drei Bands waren Bands von Fontana Records), die eine oder andere vielleicht ganz unten fünfstellig, aber das Gros blieb liegen.
Für ihre Deutschland-Tournee 1965 unterstellt er den Rolling Stones, sie hätten nur 8 Songs im Repertoire gehabt, und deshalb nur einen Auftritt von 22 Minuten hinlegen können (S. 99)!!! Wie er so etwas ernsthaft – natürlich ohne eine Quelle anzugeben – zu behaupten wagt, ist mir ein Rätsel. Das war eine Band, die 3 Jahre lang Abend für Abend in englischen Clubs aufgetreten war, und da wurde mehr verlangt, als ein 22-Minuten-Programm!! Auf der gleichen Seite schreibt er auch Quark zum Berliner Waldbühnen-Konzert der Rolling Stones.
Einiges in diesem Buch ist dem modernen Begriff der „alternativen Realität“ zuzuordnen. Zum Beispiel gibt es dieses abstruse Kapitel „Gitta Walther“, in dem er den Berufsmusikern unterstellt, auf Beerdigungen gespielt zu haben („mal wieder einen unter die Erde geigen“) (S. 119). Wenn er über die LP THE RATTLES – Twist im Star-Club schreibt, „nur einer [der Songs] war von der Band selbst geschrieben, ‚Mashed Potatoes‘“ (S. 100), dann hätte er doch bei discogs recherchieren können, um zu erkennen, dass dieser Song eine Coverversion war.
Im Kontext 60er Jahre schließt sich an das Kapitel über die Rattles übrigens das Kapitel „James Last“ an, der eine völlig andere Kundschaft bediente. Dies alles ist völlig abstrus. Dann ist er schon bei den „Billiglabels“, wo er die mindestens 30 Pseudonyme der Tonics als entschlüsselt ansieht: Jan Reetze, her mit der Liste!
Auch für das Tempo Label hat er (unbelegtes) Wissen parat: „Die einzige echte Band […] dürften die Beat Kings aus Liverpool gewesen sein.“ (S.112). Gerade diese Band kann man nicht identifizieren, aber die von ihm verleugneten Dynamits, Venture Five, The Lovers, The Blue Cats und diverse angeführte Sänger kennt man schon.
Reetze hat gelegentlich Diffamierendes im Ärmel, zu denen, die er als Alternativbewegung bezeichnet (S. 445), zu Ton Steine Scherben und Rio Reiser (S. 404), zum Thema Feminismus oder im Kapitel „Die Zukunft ruft“, wo er den politischen Aktivisten von 1968 den Ellbogenkampf um akademische Stellungen und bürgerliche Berufe unterstellt (S. 199ff). Den deutschen Bands in den 70ern (S. 215f), wirft er gar Steuerbetrug vor. Ich frage mich, ist der Autor ein wenig reaktionär gestrickt?
„Vor 1973 gab es in Deutschland keine Konzertagenturen, die sich um deutsche Gruppen kümmerten“, schreibt er (S. 219). Wie haben die Lords dann ihre Tourneen mit 250 bis 300 Auftritten pro Jahr zwischen 1965 und 1968 organisiert… per Briefwechsel? The Rainbows, nach ihrem Hit „Balla Balla“? Oder Casey Jones & The Governors als in Deutschland ansässige Hitband? Oder auch der erwähnte James Last mit seinem Orchester?
Eine tolle Gurke findet sich auf Seite 226, natürlich wieder ohne Quellenangabe: „Interessanterweise war es keine Rockgruppe (nebenbei bemerkt: die gab es damals terminologisch noch gar nicht), die als erstes mit einem eigenen PA-System anrückte, sondern die Schlagersängerin Manuela […]. Sie war mit eigener Live-Band (THE FIVE DOPS) und drei Back-Up-Sängerinnen unterwegs, und um 1966 hatte sie die Schnauze voll von den schlechtklingenden Soundsystemen in Clubs und Hallen […].“ Wer hat ihm denn das erzählt??!! Seit den 50ern brachten alle Bands ihre eigenen Anlagen mit; waren diese gut honoriert bei den Auftritten (oft Monatsjobs), dann war sie von Fender, sozusagen High End, eine Ebene darunter vielleicht nur von Echolette. Für die Beatbands ab 1965 war eine Anlage mit Vox AC30-Verstärkern das Nonplusultra; die Gesangsanlagen variierten. Auf den großen Tourneen von 1965 bauten die Bands selbstverständlich ihre eigenen Verstärkeranlagen auf, und gab es (nicht unüblich) bei einer Package-Tour zwei Konzerte am gleichen Tag, dann stand die Anlage der Lords in derStadt X und die Anlage der Black Stars in der Stadt Y. Von sogenannten PAs sprach man erst ab 1969/70. Gelegentlich brannte ein Club auch mal ab, siehe Scotty & The Silver Strings im Star-Club Mannheim, wenn dann die Anlage nicht versichert war, hatte die Band ein Problem.
Ich könnte jetzt noch eine Weile entsprechend weitermachen, so viele „sf“ (für sachlich falsch) habe ich als Randbemerkung in diesem Buch notiert. Aber ich denke, es wird deutlich, wie Reetzes Veröffentlichung einzuordnen ist. Unter „ferner liefen“, nicht unter „Standardwerke“.
Zum Buch noch eines: die schmalbrüstige Bebilderung reißt keinen aus dem Sessel – auch nicht vom Stuhl.
Der Verlag heißt halvmall – das ist niederdeutsch und heißt …? Googeln!! Klar, ne?!
Die Bonner Beatbands
Ein Kinderbild als Titelillustration für das Buch „Die Bonner Beat-Szene der 1960er Jahre“ (BonnBuchVerlag, ISBN 978-3-948568-3, 2024) zu wählen, finde ich unglücklich, denn es reduziert eben diese völlig unzutreffend auf ein Level im unteren Amateurbereich, was sicherlich nicht zutrifft. Dies vorab.
Klaus Berger als Autor dieses Buches hat ein umfassendes Kompendium der Bonner Beat Bands verfasst. Dabei geht er seinen eigenen Weg: er sortiert die Bands nach ihrem Gründungsjahr und innerhalb diesem dann alphabetisch. Dabei listet er minutiös auf, wer wann wie bei den einzelnen Bands eingetreten bzw. ausgetreten ist. Offensichtlich hat Klaus Berger bereits über Jahre entsprechende Informationen gesammelt. Deshalb kann er denn auch angeben, wo die einzelnen Bands aufgetreten sind. So ist für einen Bonner Zeitgenossen ein äußerst lohnenswertes Dokument entstanden, und die Anzahl der aufgeführten Bands ist beeindruckend.
Dieses Buch ist sprachlich nüchtern und klar, die Inhalte sind nachvollziehbar. Allerdings hätte ein wenig Esprit diesen Einträgen gutgetan, denn für einen Rezipienten, der noch keinen oder wenig Bezug zu den Gegebenheiten in den 60ern in Bonn und Umgebung hat, reduziert diese Nüchternheit und Faktenorientiertheit den Lesespaß. Obwohl den einzelnen Jahren kurze Einleitungen mit subjektiv ausgewählten wichtigen Hits aus dem anglo-amerikanischen Raum vorangestellt sind, bleibt die Einordnung in den Zeitkontext ein wenig oberflächlich. Dies wäre kein Manko, wenn Klaus Berger, der offensichtlich eine Reihe von Musikern aus dem Bonner Umfeld befragt hat, ein wenig erzählerischer vorgegangen wäre. Ein ortsfremder Leser erwartet Geschichten, die den Kontext erhellen; er erwartet mehr Anekdoten und Schilderungen von Ereignissen, die eben dieses Umfeld erhellen und sozusagen sprachlich bebildern, wie der eingebaute Warnschalter auf der Treppenstufe, um vor elterlichen Besuchen im Bandkeller zu warnen. Außer gelegentlichen Zitaten aus der örtlichen Presse verzichtet Klaus Berger aber weitgehend darauf, obwohl die Musiker aus dem Raum Bonn sicherlich vielerlei interessante und charakteristische Histörchen hätten beisteuern können.
Im Anschluss an das Bandwiki findet der Leser eine Beschreibung der Auftrittsorte und sogar eine Auflistung von überregionalen und ausländischen Bands, die in Bonn aufgetreten sind. Auch auf in der Region stattgefundene Beatfestivals nimmt er Bezug. Alles sauber recherchiert und detailliert dargelegt.
Das Buch ist reich bebildert – zu fast allen Bands und Themen konnte Klaus Berger Bildmaterial finden, zumeist in seiner eigenen Sammlung. Auch die Auftrittsorte wurden durch Fotos illustriert. Das Buch umfasst 270 Seiten gebunden im Hardcover, kostet 34,80 € und ist für einen hardcore-Sammler deutscher Beatmusik unverzichtbar, schon wegen des großartigen Bildmaterials. Es wäre schön gewesen, hätte dieses Buch das Licht der Welt vor 20 Jahren erblickt, denn nun können diverse der angeführten Protagonisten sich nicht mehr daran erfreuen.
Die Deutschen Beatbands – Update 4
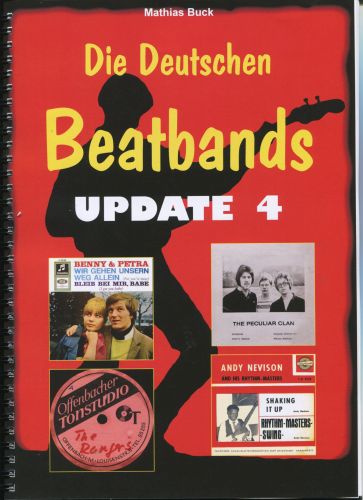 Mathias Buck hat noch einmal ein As aus dem Ärmel geschüttelt. Nun ist es schon das vierte Update zu seinem Buch Die Deutschen Beatbands (siehe Besprechung unten), und wieder hat er 80 Seiten mit Bildern und Daten von interessanten und raren Singles aus den 60ern gefüllt. Um die 400 seltene Platten hat Mathias wieder ausgegraben, und die meisten davon sind ultrarar. Eine tolle Zusammenstellung einmal mehr, und natürlich sind wieder viele Überraschunge dabei. „Ach, das es die gab!“ werden so manche bei der Lektüre denken. Mathias hat gesagt, das sei nun endgültig das letzte Update… warten wir es ab! Derweil könnt ihr das Update 4 über den Autor bestellen: Mathias Buck, per Telefon 06032-72172 oder eMail praxishopper@yahoo.de.
Mathias Buck hat noch einmal ein As aus dem Ärmel geschüttelt. Nun ist es schon das vierte Update zu seinem Buch Die Deutschen Beatbands (siehe Besprechung unten), und wieder hat er 80 Seiten mit Bildern und Daten von interessanten und raren Singles aus den 60ern gefüllt. Um die 400 seltene Platten hat Mathias wieder ausgegraben, und die meisten davon sind ultrarar. Eine tolle Zusammenstellung einmal mehr, und natürlich sind wieder viele Überraschunge dabei. „Ach, das es die gab!“ werden so manche bei der Lektüre denken. Mathias hat gesagt, das sei nun endgültig das letzte Update… warten wir es ab! Derweil könnt ihr das Update 4 über den Autor bestellen: Mathias Buck, per Telefon 06032-72172 oder eMail praxishopper@yahoo.de.
Lass dir ma‘ die Haare schneiden
Ronald M. Hahn, Horst Hinrichs, Friedhelm Hüppop, Erhard Knorr, F.P. Gunnar Kohleick, Uwe Rotter, Wolfgang Pohlmann, Horst Pukallus sind wohl die „Unterbacher Blagen“ und als solche Herausgeber des Buches „Lass dir ma‘ die Haare schneiden! Erinnerungen aus den 50er und 60er Jahren“ (Edition Köndgen 2016, 218 Seiten, ISBN 978-3-939843-68-9). Ja, da steht wirklich ‚aus‘! Und die 50er Jahre spielen inhaltlich eine sehr, sehr kleine Rolle.
Dieses Buch ist sehr unterhaltsam – so viel vorweg. Acht Autoren lassen sich über eine Zeit des Umbruchs aus – einer Zeit der sprachlosen Opposition 1 Manch Oppositionelles wurde in den Mitt-60ern über die sogenannte „Beatlesfrisur“ ausgetragen. Die Langhaarigen provozierten Ärger mit Vorgesetzten und Eltern, mussten Pöbeleien auf der Straße erdulden oder sich als Gammler beschimpfen lassen. So ist die Haarlänge die Klammer, die dieses Buch zusammenhält. In ihm wird ein Jahrzehnt portraitiert, in dem die Jugendlichen dem Musikgeschmack ihrer Eltern trotzten. Die Eltern hörten Bully Buhlan, Friedel Hensch, Rudi Schuricke, Gerd Wendland, wenn man ganz modern eingestellt war, Catarina Valente und Silvio Francesco oder Conny Froboess, doch die Teenager wandten sich den Beatbands, den Beatles, Rolling Stones 2 oder Kinks zu. Denen eifern auch in Wuppertal junge Burschen nach. So wird an einige Wuppertaler Beat-Bands und deren Entstehung erinnert, wie auch an einschlägige Lokale, in denen diese Band auftreten konnten. Auch Lebensbeichten und der Verweis auf prügelnde Väter prägen einzelne der Texte in diesem Buch.
Wuppertal-Unterbarmen war nur 4 Haltestellen mit der Deutschen Bundesbahn von meinem Wohnort entfernt, und so ist manche der im Buch erwähnten Lokalitäten und Bands in guter Erinnerung. Die Autoren selbst habe ich nie persönlich kennengelernt, aber ihre Erzählungen haben für Lesespaß gesorgt (wenn man von Horst Hinrichs Reiseberichten absieht). Autorinnen sind qua Buchtitel ausgeschlossen, denn wer hätten einem Mädchen damals empfohlen, sich die Haare zum Fassonschnitt zu kürzen!?
Die eigenwillige Versprachlichung von Friedhelm Hüppop, er nennt sie „meine eigene Lautschrift“, ist einfach wundervoll. Den Text muss man gelesen haben – nicht allein der Sprache, sondern auch des Inhalts wegen. Auch Uwe Rotter und Horst Pukallus haben mich köstlich amüsiert, Gunnar Kohleick hat nicht nur einen der schönsten Aufsätze in diesem Buch verfasst („Siehs‘ aus wie’n Lude …“), er hat auch vortreffliche Zeichnungen als Illustrationen beigesteuert. Ronald M. Hahn, Autor zahlreicher (das ist eine maßlose Untertreibung) Science-Fiction-Romane und -Sachbücher, ist der exponierteste und der Slatan Ibrahimovic unter den versammelten Autoren. Er hat nicht nur – offensichtlich – ein wunderbar nostalgisches Buch angeleiert, sondern auch ein Viertel des Buches mit eigenem Text gefüllt. Hahns Lockerheit subjektive Erfahrungen zu generalisieren, ist gelegentlich erstaunlich, aber er hat seine Erlebnisse, seine Motivation, die Widerstände, gegen die er anlief, und die generelle Begeisterung der Jugendlichen im nordöstlichen Teil Wuppertals treffend beschrieben. Allein wie das mit der Bestückung der Musikboxen in den 60er Jahren gehandhabt wurde, hat er nicht genau recherchiert, und wo er in den 60ern den Ausspruch „schwule Sau“ gehört haben will, hätte ich gerne belegt, denn dieser Begriff wird meines Wissens erst wesentlich später geprägt. Ich werde auch zitiert, leider ohne die Quelle des Zitats zu nennen…
PIM SCHEELINGS „Q65„
I bought this book about 12 years too late. Actually, I had heard of it, but sometimes things just drift off into the fog of your conscience. Anyway, this was inexcusable as Q65 was and is one of my favourite bands. As I wrote on my website, their “Revolution” album has always been a household hit and hardly has got any grooves left as often as I played it. “Q65”, written by Pim Scheelings, was published in 2010 by Ugly Things Publishing (ISBN 978-0-9778166-3-7). It took me about 5 days to devour its 200 pages. The author interviewed the 3 living members of “The Q”, as the band was generally called in the Netherlands, and also members of the bands they competed with. “Q65” makes an excellent read, the book is full of anecdotes, historical facts, contrasting personal opinions and nevertheless takes a round picture of the band that was. Their 3 periods of existence are told, the one in the 60s being the shortest, by the way. The tension that soon developed between the band members is portrayed, as well as the influence of drugs on the band. The book is written in excellent English and an exciting read all the way through. The book is illustrated with many photos most of them never seen before, but the captions leave something to be desired.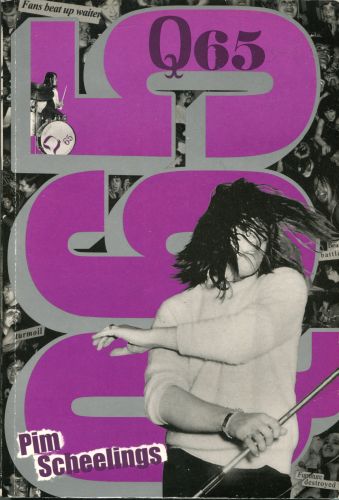
“The Q” could have made an impact worldwide in the 60s, but unfortunately, their album was never issued in the relevant markets – USA and UK – as their record company considered Willem Bieler’s accent as not suitable for an English speaking market…. How wrong they were! A cult following, however, developed in the 70s and in the 80s. The band was outstanding and 100% original, and Pim Scheelings‘ book does justice to probably the best Dutch Beat band.
JIM TOOMEY “WE WERE TOURISTS”
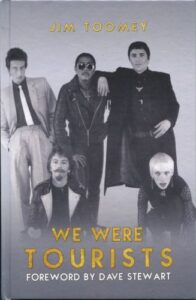
It must have been early 1979 when, during our frequent visits to the UK, my wife and I decided to spend a night at Dingwalls, one of our favourite dives in London. The band that night was a five-piece going by the (silly) name of The Tourists, a band we hadn’t heard of so far. The audience was different from the usual Punk crowds in other venues, more refined and also more stylish. The band played a tight set of powerful Pop tunes, cool enough to incite our interest. I remember that a young woman in the audience had her birthday and that the girl singer announced “a happy birthday to you”. The band was so good, that I could not but follow them for some time. Some months later the band played Cologne’s Basement (almost home turf then), and naturally we were there. The Tourists by then had released at least one 7” – and I was heavily involved in Gorilla Beat magazine, so I naturally ventured to have a chat with Peter “Peet” Coombes, the band’s rhythm guitarist, vocalist and sole songwriter. I didn’t conduct a proper interview, like I would do later on, it was just small talk, and of course I asked him what the band’s next single would be. He answered “He Who Laughs Last Laughs Longest”. I made a mental note of it and in the next issue of Gorilla Beat one could read that the forthcoming single by The Tourists would be “He Who Loves Last Loves Longest”. A blooper par excellence. Now Jim Toomey, The Tourists’ drummer, has written up the band’s history in a book that doesn’t take longer than a few hours to read: “We Were Tourists” (113 pages, Austin Macauley Publishers, London 2018, ISBN 978-178693-553-3 [hardback]). It is a far cry from the band biographies you usually get, no interviews, no research, just plain memories (obviously a bit blurred by the various intoxicants that were around the band – even Dave Stewart, the band’s lead guitarist, remarks that in the foreword). Jim Toomey is not a man of letters, thus his book reads like an essay of a highschool student. He touches a few points in The Tourists’ career, but the book doesn’t really rock. He has a few anecdotes to tell, but they are rather shallow. The Tourists had a hit single and their 2nd album sold extremely well, thus money came rolling in, but their management convinced them to park the revenues in the hands of some lawyers on Jersey, where it – naturally – disappeared without trace. When the band split up, their management asked for a settlement of a £ 34.000 debt. Music business is crooky business, we learn again. The Tourists were Peet Coombes’ band. He wrote all their material, some of it wonderful, some of it enigmatic. Their first two albums were excellent and a household hit here, then they switched to RCA to score even bigger and failed. With Dave Stewart, lead guitar, and Annie Lennox, vocals and keyboards, the band had an outstanding couple on board, and naturally everybody from outside wonders why they hadn’t been allowed more creative input, after all the duo became The Eurythmics – first-class songwriters and performers.
You can order the book from https://www.austinmacauley.com/book/we-were-tourists
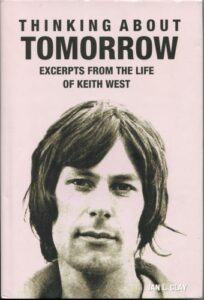 It was about time that some light was shed on Tomorrow and the consequence of their lead singer Keith Hopkins (a.k.a. Keith West) scoring big with an “Excerpt From A Teenage Opera” (“Grocer Jack”). Tomorrow was one the most elegant and versatile psychedelic Pop bands of the UK who sported an ace lead guitarist (Steve Howe), a wild drummer (John Alder a.k.a. Twink), a creative bass guitarist (John ‘Junior’ Wood) and an excellent song-writing duo (Keith Hopkins and Ken Burgess) supplying them with outstanding songs. In “Thinking About Tomorrow – Excerpts from the life of Keith West” (Hawksmoor Publishing, London 2020, 281 pages ISBN 978-1-8380990-1-5) Ian L. Clay focusses on the career of Keith Hopkins, but pays enough attention to the various band members, producers and sidemen. It’s an insightful book, although Clay was born only after Tomorrow had long dissolved. His writing is as fluent as the music composed by Keith Hopkins and his approach to his subject is adequately scientific. He draws from the relevant sources and interviewed the people involved as far as they were still available. In portraying Keith West’s life from his childhood days on into the world of Rock stardom, Clay is precise and detailed in his writing. From the rather low-key beginnings with Four + 1 via the R & B affiliation of The In Betweens the path almost inevitably leads to Tomorrow and “The 14 Hour Technicolour Dream”. Unfortunately, the band’s sole (and wonderful album) was delayed for many months and miserably promoted by their record company. At the same time their (German producer) Mark Wirtz had the idea of “A Teenage Opera” and thus together with Keith West composed and recorded a song titled “Grocer Jack” complete with orchestration and a children’s choir singing the chorus. The story is about a village grocer who “won’t come back” and thus his shop will no longer be the centre of the village. Wirtz tempted Keith West to sing lead on the demo to offer it to Parlophone for a proper release with a singer of their choice. They wouldn’t touch it. Clay reveals how John Peel, DJ at Radio Caroline, became influential in turning “Grocer Jack” into a hit record and – unintentionally – in the break-up of Tomorrow. Tomorrow soon were billed as Keith West & Tomorrow and the increasing number of teenyboppers in the audience shouted for “Grocer Jack” instead of “My White Bicycle” or “Revolution”. Clay also reveals what a rich and satisfying life as a Rock musician, songwriter, producer and family man Keith West has lived after the Teenage Opera episode to this very day. Little did I know, and to read about it made me drop my head in shame. Well, almost.
It was about time that some light was shed on Tomorrow and the consequence of their lead singer Keith Hopkins (a.k.a. Keith West) scoring big with an “Excerpt From A Teenage Opera” (“Grocer Jack”). Tomorrow was one the most elegant and versatile psychedelic Pop bands of the UK who sported an ace lead guitarist (Steve Howe), a wild drummer (John Alder a.k.a. Twink), a creative bass guitarist (John ‘Junior’ Wood) and an excellent song-writing duo (Keith Hopkins and Ken Burgess) supplying them with outstanding songs. In “Thinking About Tomorrow – Excerpts from the life of Keith West” (Hawksmoor Publishing, London 2020, 281 pages ISBN 978-1-8380990-1-5) Ian L. Clay focusses on the career of Keith Hopkins, but pays enough attention to the various band members, producers and sidemen. It’s an insightful book, although Clay was born only after Tomorrow had long dissolved. His writing is as fluent as the music composed by Keith Hopkins and his approach to his subject is adequately scientific. He draws from the relevant sources and interviewed the people involved as far as they were still available. In portraying Keith West’s life from his childhood days on into the world of Rock stardom, Clay is precise and detailed in his writing. From the rather low-key beginnings with Four + 1 via the R & B affiliation of The In Betweens the path almost inevitably leads to Tomorrow and “The 14 Hour Technicolour Dream”. Unfortunately, the band’s sole (and wonderful album) was delayed for many months and miserably promoted by their record company. At the same time their (German producer) Mark Wirtz had the idea of “A Teenage Opera” and thus together with Keith West composed and recorded a song titled “Grocer Jack” complete with orchestration and a children’s choir singing the chorus. The story is about a village grocer who “won’t come back” and thus his shop will no longer be the centre of the village. Wirtz tempted Keith West to sing lead on the demo to offer it to Parlophone for a proper release with a singer of their choice. They wouldn’t touch it. Clay reveals how John Peel, DJ at Radio Caroline, became influential in turning “Grocer Jack” into a hit record and – unintentionally – in the break-up of Tomorrow. Tomorrow soon were billed as Keith West & Tomorrow and the increasing number of teenyboppers in the audience shouted for “Grocer Jack” instead of “My White Bicycle” or “Revolution”. Clay also reveals what a rich and satisfying life as a Rock musician, songwriter, producer and family man Keith West has lived after the Teenage Opera episode to this very day. Little did I know, and to read about it made me drop my head in shame. Well, almost.
STARRY EYED AND LAUGHING „Bells of Lightning” (Aurora AUR20, 2021)
This is a wonderful album. It is just the album I needed in these dark days. Tony Poole and Iain Whitmore are responsible for another Starry Eyed And Laughing album almost 50 years after their last official release. Whitmore and Poole’s elegant voices harmonize beautifully and they chime like the Bells of Rhymney – two elder statesmen who sing like they were in their early 20s. Yes, occasionally the Byrds influence is unmistakable, but what’s wrong with that? Poole is a master of the 12-string Rickenbacker and he makes excellent use of it. Dreamyard Angels is 8-Miles-High-Byrds at their best, with a psychedelic guitar solo that will pull the tiles off your roof. In contrast Whitmore’s songs are more countryesque and recall the days of Pub Rock. As Poole and Whitmore almost equally participate in song writing, “Bells of Lightning” is varied and eclectic. I’ve been playing this album for about 20 times, and it still grows on me. There isn’t a mediocre song on it. It is full of intensity and emotion – like an early summer full-moon night. It’s an honour to listen to it before the world goes to shreds. The songs are about love, faith, broken ties, longing and forgiving – just what people experience every day. The lyrics are profound and occasionally romantic like Whitmore pleading to a child to Come Home: ‘We’ll keep your bedroom just the way it is.’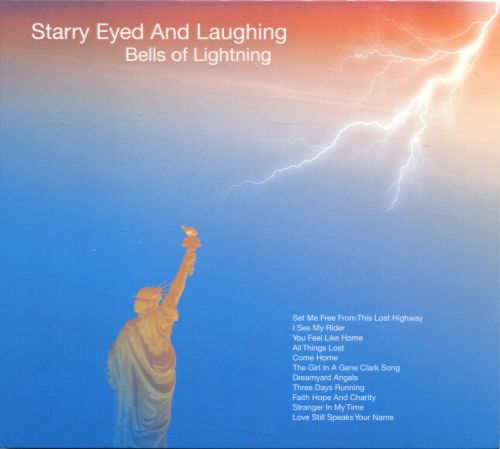
This is a guitar album as well as one of singer-songwriters. Often, albums by ageing musicians are disappointing – so I wouldn’t have taken anything as great as this for granted. Songs like Stranger In My Time are rarely written these days. Obviously, there is a lot of music fodder in the Poole/Whitmore barn. They even come up with a kind of Starry Eyed And Laughing Orchestra for Love Still Speaks Your Name. Needless to mention that the overall sound of the music is full and rich. Great job, Tony Poole!
Standing out from the lot are Faith Hope And Charity (Whitmore) where dual vocals and musical accompaniment fit beautifully and All Things Lost (Poole). If the latter song doesn’t move you, nothing will.
Unfortunately, the CD sleeve doesn’t bear comparison with the music nor does it portray it. And – don’t be irritated by the track numbering, something went wrong there.
You can order the album from https://starryeyedandlaughing.com/
Es gibt drei Herren, die sich um die Musikszene der 60er Jahre in Bremervörde und im Elbe-Weser-Dreieck3 (siehe unten) verdient gemacht haben: Jürgen Bösch, Hans Borchardt und Horst Penz. Im Eigenverlag haben sie das Buch „Beat in BRV – Die Bremervörder Beat-Szene 1962-1973 1992-2002“ herausgegeben. Im Untertitel heißt es noch: „Wie der Beat nach Bremervörde kam“. Nun, nach 1967 kann man wohl musikhistorisch nicht mehr von einer Beatszene sprechen, aber die Autoren meinten wohl, dass ehemalige Beatmusiker noch weiter versuchten, längst Vergangenes in nostalgischen Wallungen am Leben zu erhalten, obwohl es – nüchtern gesehen – bereits scheintot war.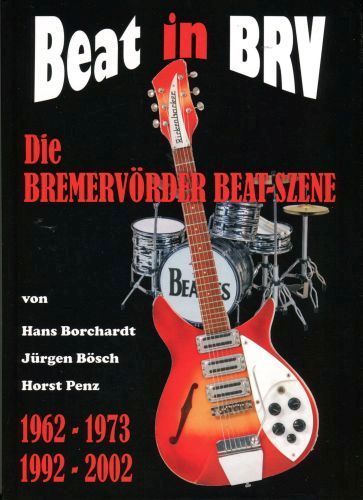
Nach einer 28seitigen Einleitung durch die Autoren Penz und Borchardt, dürfen jeweils ehemalige Bandmitglieder (wahrscheinlich ohne Honorar) ihre Bands vorstellen. Was in einigen Büchern (siehe Rezensionen weiter unten) gründlich misslang, gelingt hier sehr gut.
Die Geschichten der Bands The Outfits, Les Garçons, The Routhers sind recht konventionell, und Heinz Jahnke von The Rascals stand offenbar unter Zeitdruck, denn sein Text gerät ziemlich kurz, obwohl die Band 3 Jahre aktiv war. Die ungewöhnliche Geschichte der Funeral Furnishers PKH (PKH steht für Peters, Kröncke, Heinsohn) ist lesenswert. Aber das Highlight ist die Geschichte der Band The Mushrooms, erzählt von Peter-Paul Schnur und Horst Penz. Hier wird das Kolorit der Zeit offenbar, vieles davon abseits der Musikszene. Der Text ist sprachlich abwechslungsreich und der Ton mit einem Spritzer Selbstironie versetzt. Dass die Autoren etwas zu sagen haben, wird schon durch die Länge ihres Textes deutlich: 48 Seiten. Leider können auch sie es nicht lassen (wie bei Les 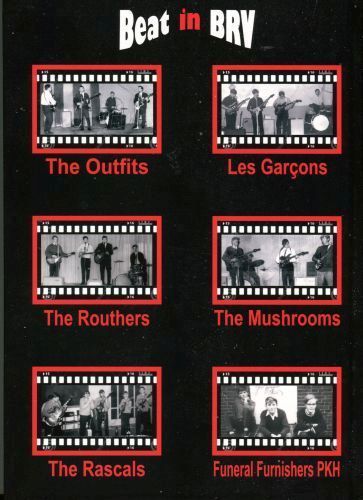 Garçons), die leidlichen Revivalbemühungen in den 90ern und 0er Jahren ausführlich darzulegen. Da werden dann stillose Fotos von Oberlippenbartträgern in karierten Hemden hinter Notenständern präsentiert, die wohl deutlich machen sollen, wie weit sich die ehemaligen Haudegen vom Rock ‘n‘ Roll entfernt haben. Diese Seiten überblättert man besser.
Garçons), die leidlichen Revivalbemühungen in den 90ern und 0er Jahren ausführlich darzulegen. Da werden dann stillose Fotos von Oberlippenbartträgern in karierten Hemden hinter Notenständern präsentiert, die wohl deutlich machen sollen, wie weit sich die ehemaligen Haudegen vom Rock ‘n‘ Roll entfernt haben. Diese Seiten überblättert man besser.
Es wird mir auch nicht klar, warum immer wieder Bilder von internationalen Rockgrößen aus verschiedenen Jahrzehnten im Text auftauchen – oder diese Bildseiten mit Gitarren (einen Bass habe ich nicht gesehen) von Rickenbacker, Gibson, Gretsch oder Fender, die für die BRV-Bands unerschwinglich waren. Auch ein Gretsch- oder Ludwig-Schlagzeug war in den 60ern ein nicht zu realisierender Traum für die durchschnittlichen Amateurbands, und über die reden wir hier. Was sollen diese Abbildungen also in diesem Buch?! Klar, sie sind schön anzusehen, aber jeder, der sich für Musik interessiert, kennt diese Instrumente und weiß, wo er diese Bilder finden kann.
Ansonsten ist das Buch mit schönen, authentischen und zum Teil recht ausdrucksstarken Fotos aus dem Fundus der Bandmitglieder illustriert. Manche Zeitungsannonce für Tanzveranstaltungen wäre verzichtbar gewesen, aber die Autoren haben halt das Zeitungsarchiv durchwühlt und sind stolz auf ihre Funde. Im Lay-Out von Horst Penz gerät manches überfrachtet und ein wenig ungelenk, aber damit kann man leben. Auch damit, dass der Leser wieder das falsche (gefälschte) Star-Club-Eröffnungsplakat gezeigt bekommt.
So sperrig wie der Titel „Vom Schlager zum Beat – Die ‘60er Wochenend – Musikszene im Elbe – Weser – Dreieck – Sternchen & Stars, Kapellen, Combos & Bands 1960 – 1969“ ist die gesamte Anlage dieses im Eigenverlag erschienenen Buches. Wieder zeichnen Jürgen Bösch, Hans Borchardt und Horst Penz verantwortlich. Die Autoren haben die lokale Presse durchforstet und Anzeigen für Tanz-/Musikveranstaltungen gefunden – und natürlich im Buch in einer überbordenden Fülle abgedruckt. Erstaunlich ist, wer in dieser sehr ländlichen Region alles auftrat: von Kenneth Spencer bis Sir Douglas Quintet, vom Medium Terzett bis Tee Set. Damit ist das Buch auch irgendwie unverzichtbar und ein wichtiges kulturhistorisches Indiz für die musikalische Diversität in der Provinz.
Zu den in der lokalen Presse angekündigten Musiker*innen und Kapellen erstellen die Autoren wikipedia-ähnliche Einträge, die jedoch in keiner Weise an den Gehalt von wikipedia herankommen. Manches ist erstaunlich dünn geraten.
Die zum Teil guten Fotos machen den insgesamt biederen Eindruck kaum wett. Zusätzlich verunstaltet der Lay-Outer manches Bild durch eingebettete Schriften, bei historischen Bildern verbietet sich so etwas. Insgesamt ist das Lay-Out dieses Buches chaotisch und völlig überfrachtet. Jegliche Klarheit fehlt, und deshalb gehen alle guten Effekte der zeitgenössischen Fotos völlig verloren. Horst Penz will alles, was er an Bildmaterial hat, unterbringen, ohne diesem den Raum zu geben, welchen es benötigt. So wird übereinandergelegt, eingebettet, verschachtelt bis zum Erbrechen.
In diesem Buch wird ohne Zweifel norddeutsches Regionalflair offenbar, zum Beispiel, wenn das Schifferklavier von den Blue Boys aus Düdenbüttel eine Rolle spielt oder wie aus den Herz Buben die Boleros wurden. Tanzlokale, die mit „Spezialität: Schinkenbrot und Erbsensuppe“ warben, gebührt sicher ein Platz in der German Club Scene Hall Of Fame.
Der Buchtitel prophezeit ja, dass man mit einer Reihe von Schlagerclowns 4 konfrontiert werden wird. In der Tat ist es witzig, über Bezirksliga-Schlagersternchen wie Grit van Hoog, Heidi Thuns. Li Li Fa (Li-Li-Fa?) oder Heidi Bachert informiert zu werden. Die haben die Welt sicher nicht bewegt, und wie bieder es im sogenannten Dreieck zuging, illustrieren die Geschichten der Kapelle Jonny Kröger und die von Karo Ass aus Ahrensweiler. „Mit der Kings Combo Tanzkapelle wird ein besonders spannendes Kapitel aufgeschlagen“, heißt es im Buch (S. 105), denn die älteren Herren traten in kurzen Hosen auf – mit Sandaletten an den Füßen und weißen Kniestrümpfen. Dafür bekommen sie nun fünf Seiten im Buch. Kommt dann aber mal etwas für mich interessantes, wie The Jumping Jacks, sind die Fotos klein und mickrig.
Wer Interesse an den Büchern hat, der schreibe Hans Borchardt: ha-borchardt@kabelmail.de
Wolfgang Welt („WoW“) war einer meiner liebsten Rockkritiker zur Punk- und New-Wave-Zeit. Er war gnadenlos ehrlich. Unbestechlich. „Michael Franks hat […] eine schlechte Angewohnheit: Er nimmt Platten auf.“ WoW war gelegentlich ein Holzfäller, aber auf der anderen Seite euphorisch und missionarisch, wenn ihm etwas gefiel. Mit seinem Gewese um Buddy Holly konnte er einem gewaltig auf den Senkel gehen, aber anderer Leute Obsessionen sind oft für Mitmenschen nervig. Da ich öfters in Bochum zu Konzerten war und ein Musikfanzine herausgab, liefen WoW und ich uns gelegentlich über den Weg. Die Gespräche mit ihm waren, aufgrund seiner anarchistischen Attitude, immer erhellend und erheiternd. Auch wenn er mir seine Schwester für ein sexuelles Abenteuer empfahl – was natürlich nicht stattgefunden hat.
Allerdings war er auch gerne mit einem Vorurteil bei der Hand: In einem seiner Bücher (ich glaube es war „Doris hilft“) zitiert er aus einem Gespräch mit mir. Conclusio: er glaube, ich möge Bo Diddley nicht. Dabei hat ein guter Freund mal behauptet, ich kenne mehr Bo-Diddley-Songs als Bo selber. Kurz vor seinem viel zu frühen Tod habe ich ihm noch mal eine Bo-Diddley-Compilation (incl.“Bo’s a Lumberjack“) gemacht, auf die ich aber keine Antwort mehr bekam. In seinen häufigen Aufzählungen der Heroen des 50er Rock ‘n‘ Roll fehlt allerdings immer ausgerechnet Bo Diddley.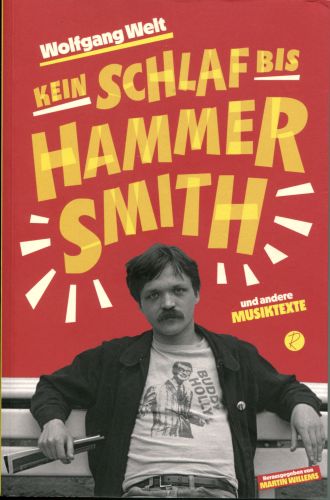
Nun hat Martin Willems (so etwas wie der WoW-Kurator) seine gesammelten Musiktexte herausgegeben: „Kein Schlaf bis Hammersmith“ (361 S., Verlag Andreas Reiffer, 2020; ISBN 978-3-945715-81-9). Ich habe das Buch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen – und keine Zeile übersprungen. Da wurden Erinnerungen wach an die späten 70er und frühen 80er. Seine Texte sprühen vor Witz und Intelligenz; und vor seinem kritischen Urteil zu bestehen, dazu gehörte schon etwas. Die Außenseiter hatten es oft leichter als die etablierten Künstler. Meistens teile ich sein Urteil. Er galt als Pedant was Fakten anbetraf, doch schleichen sich auch immer wieder ein paar Gurken in seine Texte ein. Mal verortet er die Dave Clark Five in Liverpool, dann listet er die Bands auf, die er (als 15jähriger) bei den 1. Internationalen Essener Songtagen gesehen haben will. Keine der genannten ist dort aufgetreten. Er hat das wohl mit einem später stattgefundenen Pop & Blues Festival in der Grugahalle verwechselt. Witzig fand ich Gene Vincent & The Blue Claps.
Völlig unterschreiben kann ich seine Kritik an den völlig uninteressanten Besetzungen der Rockpalast-Sendungen; und die Rockpalast-Nächte waren einfach nur übel, nicht wegen Metzgers dumpfmicheligen Ansagen – aber auch. Die Auswahl der Künstler war uninspiriert, von der Musikindustrie bestimmt und gutbürgerlich. Ich habe mich da flugs ausgeklinkt, denn es wurde nicht gerockt. Da hat der WDR es versäumt (wie immer), geschmacksbildend tätig zu werden, stattdessen hat man offensichtlich dem unzeitgemäßen Geschmack des verantwortlichen Redakteurs stattgegeben. Eine weitere Unterschrift von mir, lieber Wolfgang, unter die Bemerkung, dass die besten Versionen von Bob-Dylan-Songs nicht von ihm sind, sondern von anderen Künstlern.
Der Abschluss des Titel-gebenden Kapitels über Motörhead ist unnachahmliche Rock-‘n‘-Roll-Schreibe – unübertroffen: „[…] Eddie, Lemmie & Phil zwingen keinen zum Mitsaufen. Sehr tolerant und privat ungewöhnlich zuvorkommend. Jede Mutter würde sich einen der drei als Schwiegersohn wünschen (bei entsprechender Kleidung). Nur Lemmy, warum macht ihr eigentlich so schreckliche Musik?!“
Das i-Tüpfelchen dieser Text-Compilation (neben den guten Fotos aus diversen Quellen) ist die Möglichkeit, durch im Buch abgedruckte QR-Codes Wolfgang Welt noch einmal bei Lesungen zuzuhören. Ich wusste gar nicht mehr, wie stark seine Diktion vom Ruhrgebiet geprägt war. Jetzt höre ich ihn wieder. WoW – Du warst ein Licht im Pott!!
Jörn Rauser ist ein Hanauer Jung, und als solcher gehört er wohl einer ganz besonderen Spezies an. 1959 gründete er mit ein paar Gleichgesinnten eine Rock ‘n‘ Roll Band: The Twens. Diese waren bald regional erfolgreich, so dass sie Monatsjobs in angesagten Bars, Clubs, US-Kasernen bekamen. Sie bespielten die einschlägigen Läden zwischen Hanau, Kaiserslautern, Stuttgart und Regensburg: Colosseum, Atlantic-Bar, City-Bar, Bernhardseck, Hillbilly-Bar, Lido, Tivoli usw. Da verdienten auch die Twens gutes Geld – dennoch war Jörn immer pleite. Wie kam’s nur? 1965 gaben die Twens auf, und Jörn Rauser wechselte in einen bürgerlichen Beruf. Nun hat er ein Buch mit dem etwas sperrigen Titel Rock’n’Roll Trash – “The Twens“ >backstage< – Stories aus den wilden Sixties! (readmybook, 2020, 119 Seiten; ISBN 978-3-00-065295-0) geschrieben. Ein gutes Buch ist es nicht geworden, denn so sperrig wie der Titel ist auch Herrn Rausers Schreibe. Ja, The Twens und ihre Mitglieder werden am Rande immer mal wieder erwähnt, doch Jörn Rauser ist weitgehend mit sich selbst beschäftigt, und was den Inhalt seiner Anekdoten angeht, passt der Begriff trash ganz gut. Wenn man das Buch durchblättert, dann fällt auf, dass die Bandfotos in der Minderzahl sind; abgebildet werden zwei Dutzend Mädels – oft nackt, halbnackt, gelegentlich auch mal dezent bekleidet, mal mit, meistens ohne Jörn Rauser. Die Bebilderung korrespondiert mit dem Inhalt. Jörn Rauser definiert sich über ein bestimmtes Körperteil, und seine zum Teil wirklich unappetitlichen Geschichten spiegeln nicht den Zeitgeist der 60er Jahre wieder, sondern nur einen kleinen Ausschnitt. Auf die Schilderung von Sex mit Minderjährigen hätte ich verzichtet, aber der Mann kennt kein Erbarmen: für mich ist er was man im Englischen mit male chauvinist pig bezeichnet. Dass er die Gesichter der Mädels verpixeln ließ, um sie nicht zu kompromittieren, verstehe wer will. Entweder ganz oder gar nicht!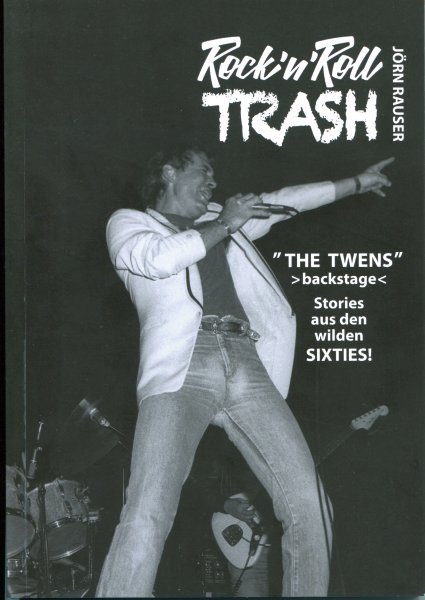
Jörn Rauser hat dieses Buch für seine beiden Kinder geschrieben, damit sie verstehen, warum er so ist, wie er ist. Wahrscheinlich haben sie nach Veröffentlichung schnell ihren Nachnamen geändert.
Und, so wird es im Buch kurz erwähnt, eine Platte sollen The Twens auch veröffentlicht haben: Baby Twist/Sweet Maria auf Bellaphon. Aber weder in Buck/Dietz Die deutschen Beatbands noch bei discogs konnte ich einen Beleg finden. Vielleicht ist ja das ganze Buch ein fake – das fände ich grandios.
GO ALL THE WAY – A Literary Appreciation of Power Pop edited by Paul Myers and S. W. Lauden (Rare Bird Books, 219, 267 Pages) is a wonderful book. Any aficionado of this musical genre will be overwhelmed by the literacy of the 27 essayists who explain not only what they have recognized as Power Pop but who also take us closer to bands, releases and musicians and how they became 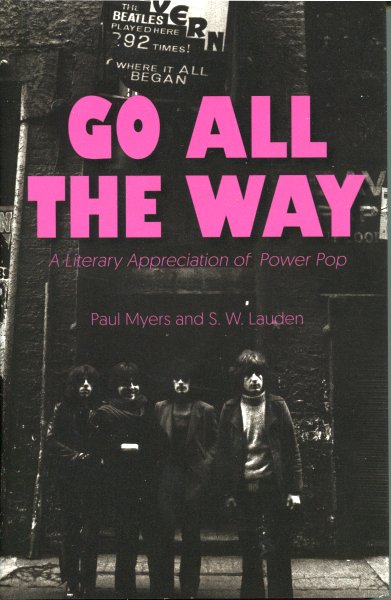 addicted to Power Pop. 27 essays bursting with knowledge, insight, emotion and expertise – all extremely well-written and intellectual. The writers of these essays are all persons of renown, be they authors, journalists, producers, musos, professors or editors. Once I started reading I couldn’t stop, and believe it or not, as soon as I had finished page 267 I read the whole book again starting from the beginning. For me, Go All The Way ranks among the Top 5 of music books.
addicted to Power Pop. 27 essays bursting with knowledge, insight, emotion and expertise – all extremely well-written and intellectual. The writers of these essays are all persons of renown, be they authors, journalists, producers, musos, professors or editors. Once I started reading I couldn’t stop, and believe it or not, as soon as I had finished page 267 I read the whole book again starting from the beginning. For me, Go All The Way ranks among the Top 5 of music books.
My wife was born in Bristol, in the borough of Clifton actually, and that’s where she has/had most of her relatives. Inevitably we would visit the city whenever we travelled around England (well, almost). Of course I would pay the local second hand record shops a visit. Clifton’s Revolver Records shop on Queen’s Road was not unknown to me when I came across RICHARD KING’s book Original Rockers (Faber & Faber 2015, 252 pages; ISBN 978-0571-31179-8). King has been working part-time at the Revolver store, perhaps the only record store without a shop window or a shopfront. You could only access the windowless (if I remember correctly) shop by climbing a steep set of stairs onto the first floor.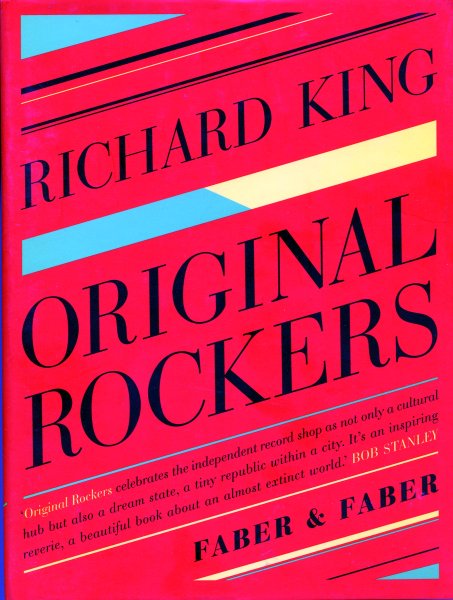
I must confess, that back then the records on display were of little interest to me, but they kept a box of rare and vintage 7” records in the backroom. You had to ask for it, which I did on each of my not too frequent visits. Once, when the box was put on the counter, I was told that I wouldn’t be able to afford them anyway – only the Japanese could. I always considered the prices at Revolver to be quite high, but from the receipt you can see that I also acquired stuff at moderate prices.
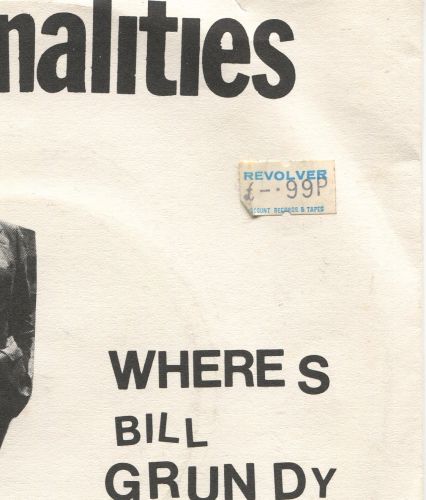

Richard Kings tells us a lot about the shop’s policy, the infatuation with Can, even a police raid that yielded no substantial amount of drugs on the premises. Revolver achieved notoriety for its exquisite selection of Reggae and Dub records, many of them Jamaican imports. With an unequalled range of pre-releases and dubplates, it became the Mecca for DJs in the 80s.
King has many a fine story to tell, for instance about Bristol’s Pop Group, the Y label and the music of Sun Ra, as well as British Jazz acts like the Spontaneous Music Ensemble or Artrock acts like AMMMusic. King also rambles about the Sea Urchins, supporting Bristol’s indie label Sarah and King’s own Planet Records label, his band Teenagers In Trouble and its hilarious plan to play cover versions of all the songs on the “Woodstock” album. We learn about his acquaintance with BBC1 DJ John Peel and the latter’s visit to Bristol as well as Revolver distribution deals and clubs and trendy pubs in Bristol. Many entertaining stories about friends, musicians, and the Revolver staff cover the anecdotal side. And: be sure that King is a versatile writer.
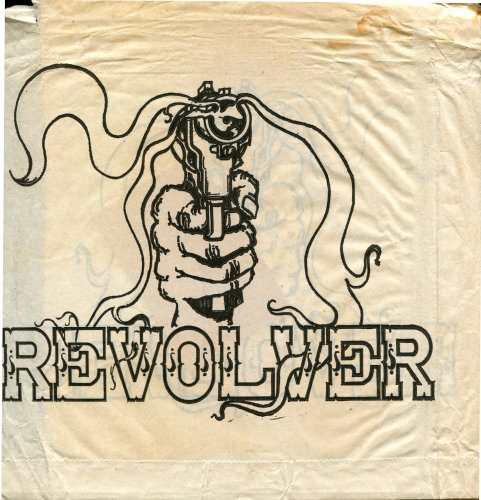
I’ve finally read Spencer Leigh’s ultimate book on the Cavern Club in Liverpool: The Cavern Club: The Rise of the Beatles and Merseybeat (Camarthen 2016, 250 pages; ISBN 978-0-85716-097-3). It is a revised and updated version of his 2008 book The Cavern, and it is as exciting as an evening (or lunch time) session at The Cavern could have been in 1964. Leigh has structured his book like a diary, naming the featured bands on as many days as could be verified. And the diary is fairly complete. He has also conducted hundreds of interviews with band members, members of the audience, Cavern staff and the people responsible for it all, and thus he graces the entries with comments, often witty, often enlightening, giving worthwhile background information and nice little anecdotes. The Cavern Club makes a thrilling 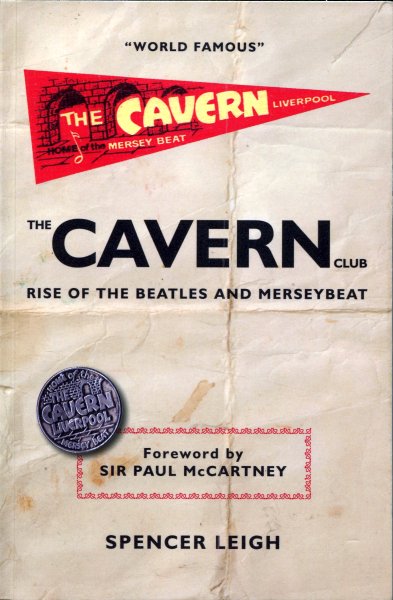 read, as the information is first hand and connected. It nicely portrays the growth of The Cavern from a Jazz cellar (mostly trad, occasionally modern) in the 50s into a Rock ‘n’ Roll club (against the owner’s conviction) in the 60s and why it played an important in the musical development of a musical style we all know as Merseybeat. By the end of the 60s the Cavern had been turned into a Heavy Metal club. It is a sad story that the The Cavern was demolished in vain and that the council of Liverpool failed to recognize the potential of such a tourist attraction. Suddenly it was no more and a car park instead and a new Cavern appeared on the other side of Mathew Street. But it wasn’t the same anymore – how could it? The end of the book is a bit ramshackle, but who cares? It’s the years up to 1967 that count. Inspired by Leigh’s writing I even got my “This Is Merseybeat” Oriole albums vol. 1 and 2 out and played them to celebrate a really enjoyable, fundamental book. If you want to know all about “The cellar of cellars” and its protagonists, this is what you need. The Beatles played at the Cavern 275 times, but the Hideaways even topped this! Everyone of importance in British Beat history appeared at this pigsty of a club with atmosphere galore: from the Rolling Stones and Downliners Sect via John’s Children and The Hollies to David John and The Mood, Herman’s Hermits, Geno Washington & The Ram Jam Band. From A (The Animals) to Z (The Zombies). And American guests like Ben E. King, Wilson Pickett or Stevie Wonder were gracing the wooden boards of the infamous Cavern stage as well.
read, as the information is first hand and connected. It nicely portrays the growth of The Cavern from a Jazz cellar (mostly trad, occasionally modern) in the 50s into a Rock ‘n’ Roll club (against the owner’s conviction) in the 60s and why it played an important in the musical development of a musical style we all know as Merseybeat. By the end of the 60s the Cavern had been turned into a Heavy Metal club. It is a sad story that the The Cavern was demolished in vain and that the council of Liverpool failed to recognize the potential of such a tourist attraction. Suddenly it was no more and a car park instead and a new Cavern appeared on the other side of Mathew Street. But it wasn’t the same anymore – how could it? The end of the book is a bit ramshackle, but who cares? It’s the years up to 1967 that count. Inspired by Leigh’s writing I even got my “This Is Merseybeat” Oriole albums vol. 1 and 2 out and played them to celebrate a really enjoyable, fundamental book. If you want to know all about “The cellar of cellars” and its protagonists, this is what you need. The Beatles played at the Cavern 275 times, but the Hideaways even topped this! Everyone of importance in British Beat history appeared at this pigsty of a club with atmosphere galore: from the Rolling Stones and Downliners Sect via John’s Children and The Hollies to David John and The Mood, Herman’s Hermits, Geno Washington & The Ram Jam Band. From A (The Animals) to Z (The Zombies). And American guests like Ben E. King, Wilson Pickett or Stevie Wonder were gracing the wooden boards of the infamous Cavern stage as well.
Da hat der Alfred Neumann sein musikalisches Leben aufgeschrieben, nicht, dass es besonders herausragend gewesen wäre, aber Geschichten aus der Regionalliga hört man immer gern. Man geht ja auch zum Bezirksliga-Fußball – stimmt, zur Zeit nicht, aber sonst. Jedoch, Lesen ist ja nicht verboten. So kam denn „Musik ohne Handkäs – Eine kurze Geschichte der hessischen Rockmusik“ (Mainbook 2017, 176 S. ISBN 978-3-946413929) neben meinen Lesesessel. Alfred Neumann ist in den 60ern mit den Offenbacher Starfighters am Start. Später spielt er in verschiedenen Popbands, die auf so unkreative Namen wie United Sounds Ltd. hören, baut sein Tonstudio und dann gehen ihm die Rodgau Monotones durch die Lappen. Alles schön und gut und geschrieben wie mit der Kneifzange: „Da der Zustand ohne Bassist mittelfristig unhaltbar war, fanden wir einen Ebensolchen.“ (S.45). Das Buch jedoch mit „Eine kurze Geschichte der hessischen Rockmusik“ zu untertiteln, ist schon starker Tobak, denn wenn das Buch eins nicht darlegt, dann die Geschichte der hessischen Rockmusik, weder kurz, noch sehr kurz, sondern gar nicht! Und „Musik ohne Handkäs“ als Titel ist auch so ein kreativer Reinfall.
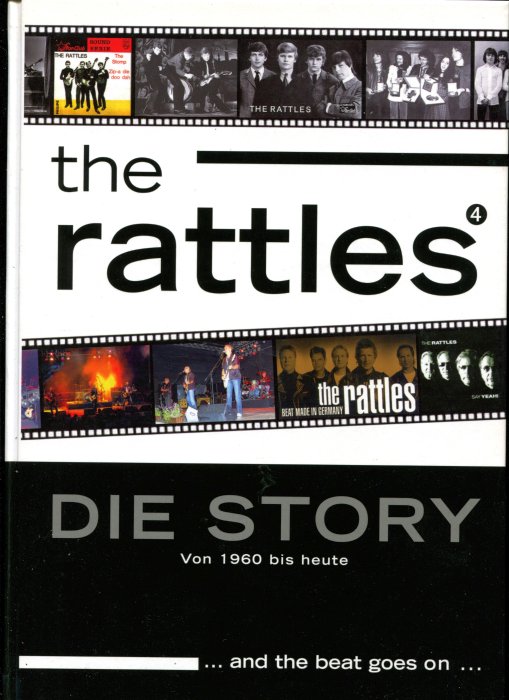
Nun gibt es auf fast 250 Seiten die Geschichte der Rattles, Deutschlands Beatband No. 2, oder doch No. 1? Jedenfalls waren sie früher als Rock ‘n‘ Roller aktiv als die Konkurrenz aus Berlin. Und immerhin haben sie einen Film gemacht, der entgegen meiner Behauptung doch eine Premiere bekommen hat. Werner Walendowski hat sich um die korrekte Historie verdient gemacht, das ist gut so. Und so zeigt er uns auch, dass es bereits vor Dieter Sadlowski bei den Harburgern gerattelt hat, auch wenn nicht mehr alle Namen bekannt sind. Das haben mir die Rattles nicht erzählt, aber ich hatte auch nicht danach gefragt. In „the rattles – Die Story – Von 1960 bis heute … and the beat goes on… ” (hommage Verlag, ca. 2008, ISBN 978-3-86735-552-0) legt Walendowski textlich bieder den Werdegang dieser Band dar, die es im Cavern krachen ließ, mit Little Richard, Everly Brothers, Rolling Stones u.a. auf England-Tour, mit den Beatles auf der Bravo-Blitz-Tournee war und ansonsten in jedem Club, Gasthof, Stadtsaal in Deutschland gespielt hat. Ja, in Holland, Österreich und Italien war sie auch. Heute rumpeln sie auf der Oldie-Schiene. Das Bildmaterial in diesem Buch ist exquisit, dafür muss man dieses Buch einfach lieben, auch wenn das Lay-out amateurhaft und unprofessionell ist. Dafür kann der Autor vielleicht nichts. Für den fehlenden sprachlichen und inhaltlichen Schwung jedoch ist er verantwortlich. Und wenn er für die Rattles nach 1967 kaum noch Worte findet, dann hat er seine Arbeit nicht gründlich gemacht.
After reading Suzanne E. Smith’s „Dancing In The Street“, I was keen on laying an eye on Berry Gordy Jr’s autobiography. Acquired via the antiquarian book trade, “To Be Loved – The Music, The Magic. The Memories Of Motown” (Headline, 1994, ISBN 0-7472-1417-4) led me deep into the Gordy family, the history of the Motown record label, the work ethics at work there, and Berry Gordy Jr.’s personal history from highschool failure to millionaire. I learned a lot about the hierarchy at Tamla-Motown, its connection to the black neighbourhood, the importance of Smoky Robinson or the song writing team of Holland-Dozier-Holland. I was aware of the fact that the Motown record label was also supporting Afro-American issues, but this was given little room in Gordy’s autobiography. He was more concerned about hit records and chart toppers. And thus I realized why a lot of the early Motown-longplayers are under par. Only later they understood that a longplaying record is a value in itself. Additionally Berry Gordy Jr. told us about his relationships to various women, but did I really want to know…?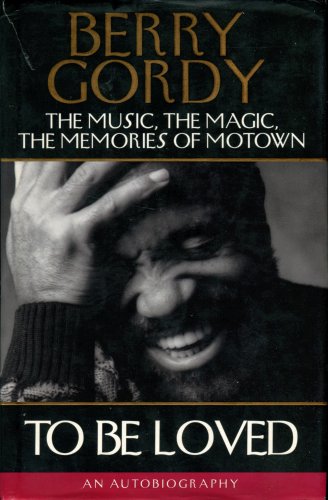
Prof. Dr.-Ing. Jan-Welm Biermann hat in den 60ern in einer Beatband gespielt, in den 70ern in einer Popband. Die Geschichte dieser Band hat er nun in einem Buch dargelegt: „The Barons – Die Geschichte einer Schülerband“. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen, um den Geburtsort dieser Band zu ergründen – es war Hasselt (bei Kleve) am Niederrhein. Gewissenhaft arbeitet Biermann die Chronologie dieser Band ab, und er garniert diese 79-Seiten-lange Story mit vielen bislang  unveröffentlichten Bildern, Zeitungsausschnitten und Plakaten. So kann der Leser entdecken, dass die Band auch im Rahmen der Ricky Shayne Show auftreten durfte. Als jemand, dem die niederrheinische Musikszene nicht vertraut ist, hätte ich mir mehr Lokalkolorit und Infos über die Beatszene dort gewünscht, aber, so Biermann: „Das Buch war ja nur für den inneren Kreis um die Barons gedacht, und so war die Erstauflage auch nur 50 Exemplare“ (im Eigenverlag, versteht sich). Dafür ist es professionell gemacht, mit Hardcover und auf hochwertigem Papier gedruckt. „Beim Cover hat mich der Drucker unterstützt, der hatte die Idee mit dem Quadratformat, quasi als Schallplattenhülle. Und dann musste auf die Rückseite auch eine Liste mit Songs, die wir gespielt haben.“ So geschah es. Bei der Erarbeitung der Story konnte Biermann auf eine große Sammlung von Zeitungsartikeln zurückgreifen, die Mutter Biermann aus den Lokalteilen der Zeitungen der Region für den Sohnemann ausgeschnitten hatte. Die Erstauflage sprach sich Dank der auch am Niederrhein funktionierenden Buschtrommeln schnell herum, und so musste nachgedruckt werden. 10 Exemplare hat Prof. Biermann noch zu liegen… zu bestellen beim Autor (janwelm.biermann@post.rwth-aachen.de). Aufgrund der großen Schrifttype liest sich das Buch relativ schnell. Ich persönlich hätte mir mehr Anekdoten, d.h. Geschichten um die Band gewünscht, um den Unterhaltungswert zu steigern.
unveröffentlichten Bildern, Zeitungsausschnitten und Plakaten. So kann der Leser entdecken, dass die Band auch im Rahmen der Ricky Shayne Show auftreten durfte. Als jemand, dem die niederrheinische Musikszene nicht vertraut ist, hätte ich mir mehr Lokalkolorit und Infos über die Beatszene dort gewünscht, aber, so Biermann: „Das Buch war ja nur für den inneren Kreis um die Barons gedacht, und so war die Erstauflage auch nur 50 Exemplare“ (im Eigenverlag, versteht sich). Dafür ist es professionell gemacht, mit Hardcover und auf hochwertigem Papier gedruckt. „Beim Cover hat mich der Drucker unterstützt, der hatte die Idee mit dem Quadratformat, quasi als Schallplattenhülle. Und dann musste auf die Rückseite auch eine Liste mit Songs, die wir gespielt haben.“ So geschah es. Bei der Erarbeitung der Story konnte Biermann auf eine große Sammlung von Zeitungsartikeln zurückgreifen, die Mutter Biermann aus den Lokalteilen der Zeitungen der Region für den Sohnemann ausgeschnitten hatte. Die Erstauflage sprach sich Dank der auch am Niederrhein funktionierenden Buschtrommeln schnell herum, und so musste nachgedruckt werden. 10 Exemplare hat Prof. Biermann noch zu liegen… zu bestellen beim Autor (janwelm.biermann@post.rwth-aachen.de). Aufgrund der großen Schrifttype liest sich das Buch relativ schnell. Ich persönlich hätte mir mehr Anekdoten, d.h. Geschichten um die Band gewünscht, um den Unterhaltungswert zu steigern.
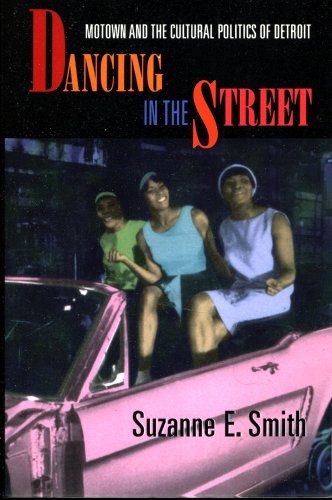 Suzanne E. Smith is an assistant professor (now a professor) at George Mason University in Fairfax, VA. She received her Ph.D. from Yale University and specializes in African American history, particularly in the importance of African American entrepreneurship. In 1999 she published “Dancing in the Street – Motown and the Cultural Politics of Detroit” (Harvard University Press, ISBN 0-674-00546-5). She shows that Motown was more than a Pop label led by black businessmen. Motown was race-conscious and politically aware. Though they had “no interest in producing music that might evoke revolutionary sentiments” (p.171), they nevertheless released spoken word records of Martin Luther King’s “I have a dream” speech (as delivered in Detroit days before the march on Washington) or of Langston Hughes’ poetry and inwardly supported the Civil Rights Movement and even Malcolm X’s Black Nationalists approach. Smith puts that into correlation with the history of the struggle of the Afro-Americans for equality and acceptance. She goes way back into American history (as far back as 1863) and she puts the rallies of the 1960s into perspective. She also exemplifies how the riots backlashed and hurt the cultural activities of the Black communities and resulted in police aggression. Smith enrols the history of the Afro-American struggle for freedom in relation to the development of (Tamla) Motown as a record label. It’s decline and the parallel demise in cultural significance came when Tamla Motown moved to California. “Dancing in the Street” isn’t an easy read as it goes into detail and is bound to academic practice. However, it taught me more about American history and the music of Motown than whatever I had read before. “The Motown sound was always ‘brown’, regardless of the company’s diverse musical output and its popularity with multiracial audiences.” (p. 167). Motown’s big achievement was to make music made by Afro-Americans popular among a white audience. I had always thought of Martha & The Vandellas “Dancing In The Street” as a having-a-good-time pop song, but I’d never read the lyrics in connection to the Afro-American rallies for freedom and justice.
Suzanne E. Smith is an assistant professor (now a professor) at George Mason University in Fairfax, VA. She received her Ph.D. from Yale University and specializes in African American history, particularly in the importance of African American entrepreneurship. In 1999 she published “Dancing in the Street – Motown and the Cultural Politics of Detroit” (Harvard University Press, ISBN 0-674-00546-5). She shows that Motown was more than a Pop label led by black businessmen. Motown was race-conscious and politically aware. Though they had “no interest in producing music that might evoke revolutionary sentiments” (p.171), they nevertheless released spoken word records of Martin Luther King’s “I have a dream” speech (as delivered in Detroit days before the march on Washington) or of Langston Hughes’ poetry and inwardly supported the Civil Rights Movement and even Malcolm X’s Black Nationalists approach. Smith puts that into correlation with the history of the struggle of the Afro-Americans for equality and acceptance. She goes way back into American history (as far back as 1863) and she puts the rallies of the 1960s into perspective. She also exemplifies how the riots backlashed and hurt the cultural activities of the Black communities and resulted in police aggression. Smith enrols the history of the Afro-American struggle for freedom in relation to the development of (Tamla) Motown as a record label. It’s decline and the parallel demise in cultural significance came when Tamla Motown moved to California. “Dancing in the Street” isn’t an easy read as it goes into detail and is bound to academic practice. However, it taught me more about American history and the music of Motown than whatever I had read before. “The Motown sound was always ‘brown’, regardless of the company’s diverse musical output and its popularity with multiracial audiences.” (p. 167). Motown’s big achievement was to make music made by Afro-Americans popular among a white audience. I had always thought of Martha & The Vandellas “Dancing In The Street” as a having-a-good-time pop song, but I’d never read the lyrics in connection to the Afro-American rallies for freedom and justice.
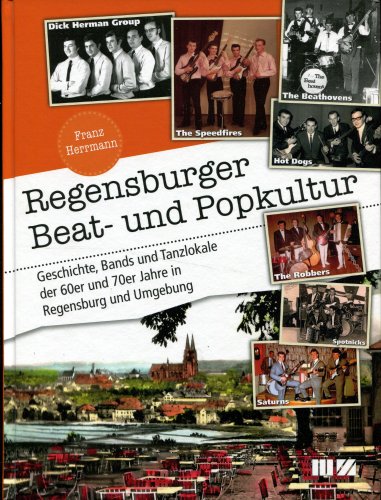 „Diese Formation war mitunter die schönste meiner Musikerzeit“ – Vitus Dorfner (S. 285)
„Diese Formation war mitunter die schönste meiner Musikerzeit“ – Vitus Dorfner (S. 285)
1. Die interessanteste und heißeste Regensburger Band hat der Autor nicht erwähnt: The Mystic Eyes. Waren ihm wohl zu wild.
2. Ganz ehrlich, ich kriege Pickel, wenn ich Namen wie Wilson Pikett, The Throggs, Herman’s Hermit und Jimmy Hendrix sowie Songtitel wie Rout 66, The Rise And Fall Of Fingel Bunt, oder Heartful Of Soul in einem Buch lese. Dann weiß ich, da war kein Lektor involviert. Bücher macht man mit Sorgfalt! Wenn man zudem in den Mittsechzigern My Bonnie von The Rattles gespielt haben will, dann bekomme ich auch noch einen Kropf. Ein zweiter Kropf wächst mir, wenn ich (S. 207) den „Original Songtext von Che Sara“ lese: Eise mio que stei su la colina – distesso come umbre avec domentato. Der Text von Che Sarà beginnt aber: Paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio addormentato.
Solche und andere Lapsus findet man im Buch „Regensburger Beat- und Popkultur – Geschichte, Bands und Tanzlokale der 60er und 70er Jahre in Regensburg und Umgebung“ von Franz Hermann (Regenstauf 2014; ISBN: 978-3-86646-304-2). Das Wort Geschichte hätte ich aus dem Titel gestrichen, denn eine Geschichte von Regensburg in den 60er und 70er Jahren erzählt das Buch nicht.
Franz Hermann hat sich größte Mühe gegeben – und sich ein Fleißkärtchen verdient. Er hat wohl die meisten relevanten Bands zur Mitarbeit aufgerufen und viele Fotos für die Illustration gewinnen können, hat über die Veranstaltungen erfolgreich recherchiert, die einschlägigen Tanzlokale minutiös aufgeführt und die Instrumente und elektronische Verstärker dargestellt (allerdings nur die der großen Hersteller). Seine soziokulturellen Ausführungen zur Beat-Ära jedoch sind klischeehaft und oberflächlich, ebenso die Beschreibungen von Mode, Autos (hier vergreift er sich an Neuwagen, während die Bands im DKW F89 oder BMW 700 unterwegs waren) und Medien (da bezichtigt er die Bravo, Informationen geliefert zu haben).
Obwohl es in Regensburg seit September 1962 die Tanzhalle Colosseum, später Tanzpalast Colosseum, in der Regie von Israel Offmann gab, in der viele englische Bands und die wildesten deutschen Kapellen in Wochen- oder Monatsjobs getobt haben, scheint dies auf die meisten Bands in Regensburg wenig abgefärbt zu haben. Sie haben fast alle ihre Fliegen und Krawatten nicht abgelegt und blieben konservativ und erscheinen mir recht hinterwäldlerisch. Das Schifferklavier war vielen Bands noch heilig. Mit Perücken versuchte man, den Beatles nahe zu kommen (S. 293 u.a.). The Robbers: Unser Repertoire enthielt – der damaligen Zeit entsprechend – natürlich ein „Ave Maria“ (dreistimmig gesungen)! (S. 243). The Saturns: In unserem Programm hatten wir selbstverständlich auch traditionelle Tanzmusik wie Cha Cha Cha, Tango, Walzer etc. und auch gängige deutsche Schlager wie z.B. „Schwarzer Engel“ von Caterina Valente. Ein sehr schönes Lied mit einem sehr guten Text.“
Irgendwelche Schlagersternchen zu begleiten war den Regensburger Bands – so sie denn über die musikalischen Fähigkeiten verfügten – gemäß Franz Hermann kein Problem. Wenn Hermann die Regensburger Beatszene beschreibt, dann klingt das so: „Die Männer haben ihre Jackets abgelegt, das Gedränge auf dem Parkett ist beachtlich. Eine einheitliche Bekleidung der Musiker war damals noch obligatorisch und so sind die drei Frontmänner auf ihrem erhöhten Podium immer gut auszumachen. (…) Die Anhängerschaft der Band kennt deren musikalisches Programm recht gut und so werden Wünsche geäußert und erfüllt: If I were a carpenter, The legend of Xanadu, Mighty Quinn, San Antonio Rose – die Stimmung im Laden ist nicht mehr zu toppen. Das Bedienungspersonal leistet Schwerstarbeit. Während der Tanzphase ist kaum ein Durchkommen möglich – die kurzen Pausen müssen genügen, um die Getränke fix an Ort und Stelle zu bringen.“ (S.38) Das erzeugt bei mir kein Prickeln. Ich hätte wahrscheinlich das Weite gesucht.
Die Dick Herman Group, in dem der ex-Regensburger Domspatz Franz Hermann die Klampfe bearbeitete, wird im Buch ganz intensiv dargelegt. Diese Kapelle war auch im Tonstudio, um Sweet Inspiration mit deutschem Text einzuspielen. Das Ding ging so: Oh, schenk mir sweet sweet inspiration, dann bin ich nie so allein, niemals mehr so allein, mit deiner sweet sweet inspiration, da kann ich immer bei dir, immer bei dir sein… (S. 213) Veröffentlicht wurde diese Nummer – gottseidank – nie, aber ich hätte mir als Autor auch verkniffen, diesen inhaltlichen und sprachlichen Ramsch in einem Buch abzudrucken. Dagegen waren die Texte von Roy-Black-Songs ja literarisch.
Ich denke nicht, dass Franz Hermann vom Honorar dieses Buchs ein Reihenhäuschen hat bauen können, doch wenn es so war, dann hatte er einen genialen Schachzug auf Lager: ich lasse die Bandmitglieder einen Großteil des Buchs, nämlich die Bandgeschichten, für mich schreiben. So beauftragt er jeweils einen Musiker aus den einschlägigen Bands, eine Bandgeschichte zu verfassen. Dies hat natürlich diverse Nachteile.
- ist so keine geschichtswissenschaftliche Relevanz zu gewährleisten,
- öffnet man der persönlichen Eitelkeit Tür und Tor,
- überlässt man Autoren das Feld, welche in der Regel nicht die sprachlichen (und manchmal auch die intellektuellen) Fähigkeiten besitzen, um eine tragfähige Bandhistorie darzulegen, Beispiel aus The Robbers: Neben dem Kontrabass spielte er auch Elektrobass (was damals gerade anfing, modern zu werden) und Keybord [sic], welches als Instrument zu der Zeit groß im Kommen war. (S. 242)
- sind auf diese Weise Redundanzen ohne eingreifendes Lektorat unvermeidbar,
- sind das Resultat eher langweilige Aufzählungen von Bandbesetzungen und Auftrittsorten, aber selten Bandgeschichten, die sich um Anekdoten und (skurrile) Ereignisse (wie bei the Speedfires und the Skyriders) reihen, welche eine Bandgeschichte erst lesenswert machen.
All dies ist hier von Bedeutung. Zitat bei The Hot Dogs: „Leider haben wir es nur auf den zweiten Platz geschafft, da unser Drummer Roy Orbinson’s [sic] Pretty Woman unendlich langsam eingezählt hatte, und wir vor lauter Angst nicht abbrechen wollten.“ (S. 224)
Man mag es kaum glauben, was von The Saturns in diesem Buch zur Beat-Ära vorgetragen wird: „Sonntags gegen 22:00 Uhr, stand er [der Wirt Franz Handerer] immer mit Tränen in den Augen an der Tanzfläche, wir dagegen hatten ein Lächeln im Gesicht! Der Anlass waren zwei Lieder, die ihn immer wieder bewegten ‚Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand‘ und das ‚Fiakerlied‘.“ (S. 248) Na, bravo, die Band darf nächste Woche wiederkommen.
Zum Schluss möchte ich Herbert Hoffmann von den Spotniks (wer kommt auf so einen dreisten Namen?!) noch wortwörtlich (!) zitieren: „Ein Wendepunkt war, als mein Enkel Jannik mich gefragt hat, ob ich ihm das Gitarre spielen lernen möchte. So war ich im vorgerücktem Alter nochmals gefordert, meine Kenntnisse und mein Wissen weiterzugeben. Heute wird ganz anders gespielt. Daß es andere Musikrichtungen gibt, war für mich eine reiche Erfahrung, die ich nicht vermissen möchte.“ (S. 290) Für diesen grammatischen Murks hätte man die Lords schon 1965 gekreuzigt!
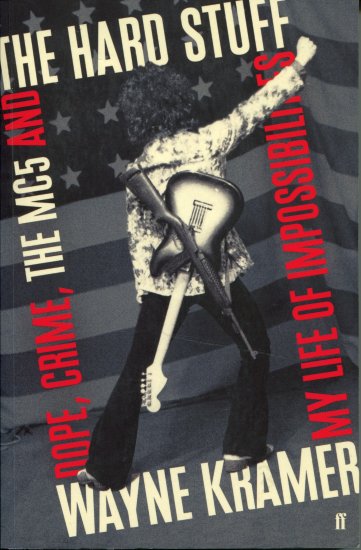
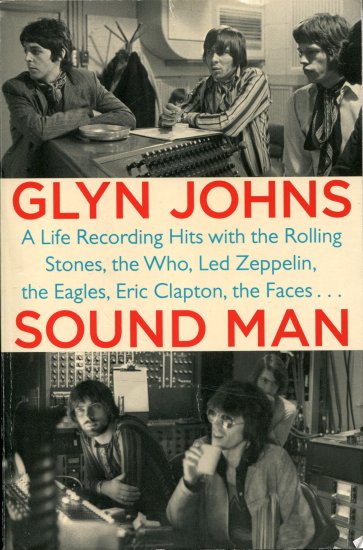
The sound man is not a man of letters, yet he has written a book accumulating about a million words: Glyn Johns “Sound Man” (Plume, New York, 2015 – ISBN 978-0-14-751657-2). Glyn Johns was a sound engineer and occasional producer mainly known for his work in the 60s and 70s. He did the sound engineering on albums by The Rolling Stones, The Small Faces, The Eagles, The Who, Fairport Convention and many others. The sound he achieved in the studio was sharp and crisp and voluminous, yet his writing is shallow and thus the book drags along like a tortoise on land. It does not rock. Though he had an ear for Rock ‘n’ Roll, his life style was the opposite. When travelling he even dressed as conventionally as possible – suit and tie – to avoid attracting attention. Perhaps Glyn Johns is the only person in Rock ‘n’ Roll business to never have touched any drugs apart from cigarettes. Glyn Johns obviously was someone who knew it all, and not someone ready to compromise: “I had a disagreement over the content of the second album [of the Ozark Mountain Daredevils] with Stanley Plesser, the band’s manager – a man who should have stuck to selling shoes, in my opinion. This resulted in me quitting…” (p. 151).
When Johns is fond of a person, he finds ways to express it. “When I was an engineer I would see him almost every day, and a nicer guy you could not wish to meet” (about John Bonham, p.115). And “He was softly spoken, always casually dressed, with a cultured English accent and an air of relaxed confidence about him…” (about Chris Blackwell, p.79). Or: “You won’t meet a nicer guy. He is generous to a fault and a true professional to work with” (about Graham Nash, p. 72). And so on and on, yet occasionally he also picks on the negative sides of people, like the violent streak in Don Arden (p. 66).
The things he says about Germany are more than just irritating, they are stupid; I bet he is a Brexiteer.
By reading Johns’ book you will get a lot of inside stories, some of them interesting, but also a lot of self-praise and irrelevant side-information.
I started to read Wayne Kramer’s “The Hard Stuff – Dope, Crime, the MC5 & My Life Of Impossibilities” (Faber & Faber, London, 2018 – ISBN 978-0-571-34126-9) with the great expectation that now my love for the MC5 would finally be given the substantiation it needed. Hadn’t I followed them from the moment German Sounds magazine told me of their existence (resulting in an adventurous mail order of their first album in the USA) to all the bands that were founded by the ex-members after the MC5’s collapse in 1972? You can be sure I’ve got the uncensored version of the Five’s first album sitting nicely on my shelf, but I’d also like to tell you that I did not learn anything really relevant about the MC5 apart from what I knew already. Kramer’s story is not a revolutionary one – despite his involvement in the White Panthers – it’s a sad story. Like most of the finally cleaned-up drug addicts, Kramer is more concerned about illustrating his life as a drug user and – in his case – a petty thief, burglar, robber, class A criminal as a life of living in the trenches. His arrogance towards musicians with an addiction while an addict himself is disturbing (p. 260). Am I really interested in Wayne’s extensive stories of drug and alcohol abuse and how he deferred any outward treatment until he finally found the clue to his disturbed personality: he was a “fatherless child” (p. 237)? Pages and pages are wasted on his fits of self-discovery and self-knowledge and all the pseudo-psychological explanations of his doings, equivalent to the time it took Wayne to finally get his act together. Instead of drugs and crime, Wayne informs us, that his “wife and son have become the centre of my universe. We are like the nucleus of an atom, spinning around each other and holding on to what we have together” (Forword). Let’s hope the son will see it likewise when he is older. Wayne’s mother died solitary. I really hated the lachrymose undertone in Wayne’s book, even when referring to the end of his Epitaph deal (p. 252ff). It took him more than 60 years of realising what he was: “the kind of guy I couldn’t stand to be around: a loud-mouthed, ego-tripping, drunken, rock & roll asshole” (p. 261). Well, if you want to read as far as this to wait for the resurrection of W.K., this book is good for you. I was disturbed, yet I personally wish Wayne Kramer all the joy in the world now that he has finally found his way to mental and physical peace. His story how he learned Jazz from Red Rodney (named Albino Red to be able to play in Charlie Parker’s band in the South of the USA) in prison is fascinating (p. 185ff). As is the story of Nathan Cohen (p. 195) taking over the prison newspaper, revealing more about the US correctional system than any scientific research. And – thumbs up: Wayne Kramer is a man of letters. „The Hard Stuff“ is fluid, eloquent and sharp.
“I refused to be a slave on a plantation”
His plantation is Stax Records. Booker T. Jones, Memphis multi-instrumentalist who can play the clarinet, the oboe, the saxophone, guitar, bass, piano, organ, drums and more, has written his biography “Time Is Tight – My Life, Note by Note” (Omnibus Press, 2019, ISBN 978-1-913-17219-0). And it turned out to be a really unconventional book, as Jones is criss-crossing through time and place. Divided into short essays the book tells us of Jones’s youth, his first sessions at Satellite Records, his first live appearances, the formation and success of Booker T. & The MGs, the fertile years as a part of the Stax Records recording team, his move away from Memphis to the West Coast, his career as a composer of movie soundtracks etc. – and not necessarily in this order. This is another patchwork blanket, but one that makes sense. His private life is laid out like a map. And how he came to be playing bass on Dylan’s “Knockin’ On Heaven’s Door” or his house was pulled out to sea, how his third wife introduced him to literature, and I guess, without her this book would not have been possible. We are told how Booker T. and The MGs (plus the Mar-Keys’ horn section) backed Otis Redding at the Monterrey Festival which was Redding’s US breakthrough. Booker T. Jones and his bandmates were also part of the Stax/Volt Revue that was met with sold-out shows and unprecedented fan enthusia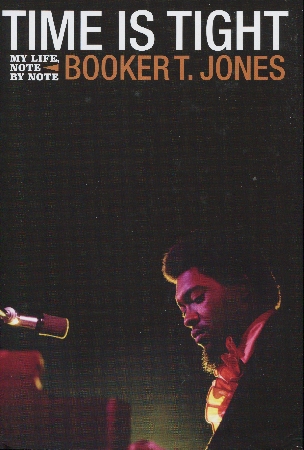 sm in Europe in 1967. Surprisingly Jones does not even mention it. No words on the 1993 tours with Neil Young or the collaboration with Creedence Clearwater Revival, but on playing in the White House with Barack Obama attending in shirt-sleeves or a year later even with the President singing a few bars of “Let’s Stay Together”.
sm in Europe in 1967. Surprisingly Jones does not even mention it. No words on the 1993 tours with Neil Young or the collaboration with Creedence Clearwater Revival, but on playing in the White House with Barack Obama attending in shirt-sleeves or a year later even with the President singing a few bars of “Let’s Stay Together”.
Jones had not always been treated fairly by Stax Records (not only exploiting his potential as an artist – p.206 – but also obviously cutting him low on royalties and denying him publishing rights –p.162), by his fellow musicians (Steve Cropper recorded and released a Booker T. & The MGs without telling Booker T. about it and with a different organ player), by his wives (cheating on him and wasting his money without his consent), by life in general (losing one of his sons early). So let us grant him a (generous) bit of name dropping. He tells us about all these things, and also about many songs in detail, yet his lengthy descriptions of chord progressions are a bit tedious. Also the book loses momentum towards the end due to the fact that Booker T.’s career loses momentum. His political awareness always shines through, also when he cites from an interview in which Steve Cropper accuses Dr Martin Luther King of being responsible for his own death (p.160). Even before finishing the book we have learned who Booker T. was with all his faults, bragging, weaknesses, faculties.
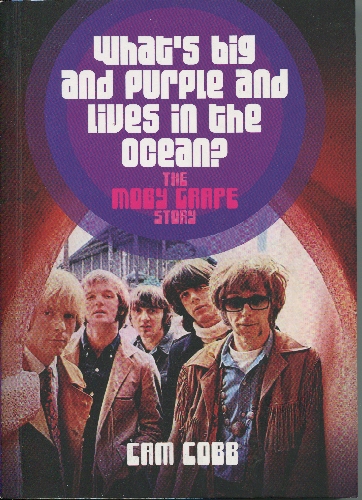 I thought it might be a good idea to buy a book written by a professor born in 1972 about a band that had broken up twice even before the author was born. So I acquired “What’s Big And Purple And Lives In The Ocean” by Cab Cobb (Jawbone, 2018, ISBN 978-1-911036-31-9): the story of San Francisco’s Moby Grape, a name that was owned by their manager and consequently at one stage two Moby Grapes were performing with the original band being forced to appear as The New Moby Grape. Interestingly Cobb is putting the cart before the horse and starts the Grape history with the 1971 re-union of the band. The book was an interesting read as the author interviewed almost the whole inner circle of the band and thus tells interesting anecdotes and gives first-hand information. However, as he refers to the same things again and again, there is quite a number of redundancies in the book like the re-scheduling at the Monterrey Festival or the 5-singles-release of their debut album. On the other side, this book goes into the history of Moby Grape as deep as you can, yet I can’t remember Cobb explaining how the name of the band came about or what Skip Spence’s real name was (Alexander Spence). The book is a large patchwork blanket, and it seems as if Cobb wanted to make the history of the band as complicated as possible. Whenever a town or a place crops up, Cobb gives us a geography lesson or an architectural history. He mentions as many Moby Grape performances as possible, but a list of shows would make the band’s zig-zagging through the US more evident. His detailed and longish descriptions of the songs on certain albums are boring at times, also his strangely fictitious record companies executives’ rant (over five pages) how to promote Moby Grape. The five-singles-idea is described in detail, when Cobb suddenly exclaims “then the shit hit the fan” (p.188). If you now expect an explanation or the story behind it, you will be disappointed. Cobb has got yet another story to tell. On the Grape’s debut Cobb is about to tell us that it is “a thirteen-song album of freedom. It is also about free love, being in a place where people can love one another for a time, perhaps in the morning, and they part ways not sad but happy for having known and been with one another.” (p. 151) Well, Cam Cobb, aren’t you talking about sex here? Then he waxes philosophical: the album is “a whole world and within this world are feelings of happiness and despair. Feelings of purposelessness and sadness lurk in the midst, but through the songs these five musicians find ways of coping, so they look forward to the future while living in the here and now.” Speech bubbles and… that does not really sound like an album of “freedom” to me. Afterwards he elaborates on the album for 18 pages, like he does on “Wow/Grape Jam” which he got to know in parts over like 10 years. It’s just making me disorientated. Yet, when Cobb is firmly with his feet on the ground mentioning the management politics that influenced the course of Moby Grape, I can follow him. While reading Cobb’s biography, I got out my Moby Grape albums – and though for me the (mono!) debut of this extraordinary three-guitars-four-vocalists band was always the album miles above the others – I enjoyed “Wow/Grape Jam”, “’69” and “20 Granite Creek” more than ever. Thanks to Cam Cobb.
I thought it might be a good idea to buy a book written by a professor born in 1972 about a band that had broken up twice even before the author was born. So I acquired “What’s Big And Purple And Lives In The Ocean” by Cab Cobb (Jawbone, 2018, ISBN 978-1-911036-31-9): the story of San Francisco’s Moby Grape, a name that was owned by their manager and consequently at one stage two Moby Grapes were performing with the original band being forced to appear as The New Moby Grape. Interestingly Cobb is putting the cart before the horse and starts the Grape history with the 1971 re-union of the band. The book was an interesting read as the author interviewed almost the whole inner circle of the band and thus tells interesting anecdotes and gives first-hand information. However, as he refers to the same things again and again, there is quite a number of redundancies in the book like the re-scheduling at the Monterrey Festival or the 5-singles-release of their debut album. On the other side, this book goes into the history of Moby Grape as deep as you can, yet I can’t remember Cobb explaining how the name of the band came about or what Skip Spence’s real name was (Alexander Spence). The book is a large patchwork blanket, and it seems as if Cobb wanted to make the history of the band as complicated as possible. Whenever a town or a place crops up, Cobb gives us a geography lesson or an architectural history. He mentions as many Moby Grape performances as possible, but a list of shows would make the band’s zig-zagging through the US more evident. His detailed and longish descriptions of the songs on certain albums are boring at times, also his strangely fictitious record companies executives’ rant (over five pages) how to promote Moby Grape. The five-singles-idea is described in detail, when Cobb suddenly exclaims “then the shit hit the fan” (p.188). If you now expect an explanation or the story behind it, you will be disappointed. Cobb has got yet another story to tell. On the Grape’s debut Cobb is about to tell us that it is “a thirteen-song album of freedom. It is also about free love, being in a place where people can love one another for a time, perhaps in the morning, and they part ways not sad but happy for having known and been with one another.” (p. 151) Well, Cam Cobb, aren’t you talking about sex here? Then he waxes philosophical: the album is “a whole world and within this world are feelings of happiness and despair. Feelings of purposelessness and sadness lurk in the midst, but through the songs these five musicians find ways of coping, so they look forward to the future while living in the here and now.” Speech bubbles and… that does not really sound like an album of “freedom” to me. Afterwards he elaborates on the album for 18 pages, like he does on “Wow/Grape Jam” which he got to know in parts over like 10 years. It’s just making me disorientated. Yet, when Cobb is firmly with his feet on the ground mentioning the management politics that influenced the course of Moby Grape, I can follow him. While reading Cobb’s biography, I got out my Moby Grape albums – and though for me the (mono!) debut of this extraordinary three-guitars-four-vocalists band was always the album miles above the others – I enjoyed “Wow/Grape Jam”, “’69” and “20 Granite Creek” more than ever. Thanks to Cam Cobb.
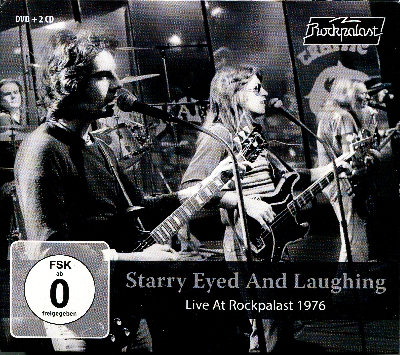
Starry Eyed And Laughing, one of this house’s favourites, have finally had their Rockpalast show released on DVD. They played 17 songs with a short-lived line-up before the band broke up. Roger Kelly had joined SEAL to replace Ross McGeeney who had left the band. Shortly before the Rockpalast show, McGeeney re-joined and thus a 5 piece band performed a well-rehearsed 77-minute set. It’s all excellent Gibson SG, Fender Telecaster and Rickenbacker 12-string guitars. The interplay of the guitars is stunning, and the almost angelic vocals match the sound perfectly. Even on the Rockpalast stage the SEAL’s sound, which is more than a nod to the Byrds and other West Coast luminaries, comes across extremely well. “Live At Rockpalast 1976” (MIG 90942, 2019) comes in a generous triple fold-out cover with a) the DVD of the show, b) an audio CD of the show and c) a CD of studio versions of the songs performed as far as studio versions exist. All graced with brilliant photos taken at the show. This is a first-rate set and a must for anybody who fishes in sincere and well-played down-to-earth Rock music. However, the music could have done with a bit more punch.
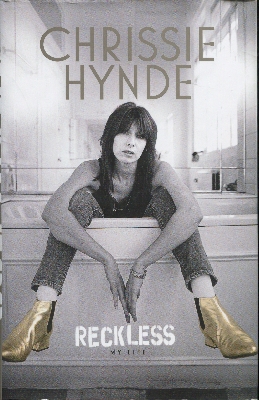
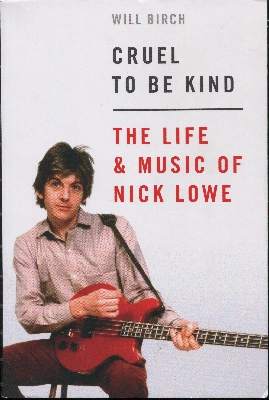 I did not enjoy Chrissie Hynde’s autobiography “Reckless – My Life” (Ebury Press, 2015, ISBN 978-1-78503-144-1) very much. About half of the book covers Chrissie’s teenage years, her drug consumption and her peer groups (among them motor cycle dumbheads) in Ohio. Already in her twenties she relocates to London, where she meets writer Nick Kent and with his help becomes a rock critic. She works in Malcolm McLaren’s and Vivienne Westwood’s SEX shop – we get a brief introduction of Miss Hynde’s into the up-coming London Punk scene – before she tells us about the formation of The Pretenders in 1978. She elaborates on the Pretenders Mk. 1. But that’s about it.
I did not enjoy Chrissie Hynde’s autobiography “Reckless – My Life” (Ebury Press, 2015, ISBN 978-1-78503-144-1) very much. About half of the book covers Chrissie’s teenage years, her drug consumption and her peer groups (among them motor cycle dumbheads) in Ohio. Already in her twenties she relocates to London, where she meets writer Nick Kent and with his help becomes a rock critic. She works in Malcolm McLaren’s and Vivienne Westwood’s SEX shop – we get a brief introduction of Miss Hynde’s into the up-coming London Punk scene – before she tells us about the formation of The Pretenders in 1978. She elaborates on the Pretenders Mk. 1. But that’s about it.
Chrissie Hynde, however, tells us how she pushes a 3-song (or was it 4-song?) demo tape on Nick Lowe, and what came of it. The story is repeated in “Cruel To Be Kind – The Life & Music of Nick Lowe” by Will Birch (Constable, 2019, ISBN 978-1-47212-917-8).
Don‘t expect Will Birch to write well. No, he writes extremely well, he has just got it in him, and thus he has created an excellent biography of one of England’s most prolific Pop writers and musicians: Nick Lowe. After writing the outstanding book ”No Sleep Till Canvey Island: The Great Pub Rock Revolution”, he has now set another landmark in Rock writing. Will Birch, once a member of the Pub rockin’ Kursaal Flyers and then of the Power Pop masters The Records, knows what he is writing about. He has witnessed the British music scene of the seventies and eighties from the inside circle. He also is a close friend of Nick “Basher” Lowe, but don’t expect adulation and white washing. Birch describes the negative sides of Nick’s character, his faults as well as his weaknesses and how Nick was nearly strangled by the Kinks’ Ray Davies in a fit of anger. And of course, he is true to the facts when it comes to addictions and alcohol or drug misuse.

For me, Nick Lowe will always be primarily important as one fourth of the best ever British Rock ‘n’ Roll band: Rockpile. Live they were a no-gimmicks powerhouse, extremely tight and versatile at their instruments. No diverting stage banter, just “1 – 2 – 3 – 4”! Their shows just blew you away with sheer energy and musicianship. For contractual reasons they, unfortunately, were only able to release one album under their own name, and that was their weakest – the steam had gone out of the kettle. You’ll find the Rockpile members’ names – Terry Williams, dr, Billy Bremner, gtr, voc, Dave Edmunds, gtr, voc, Nick Lowe, b, voc, on various Edmunds and Lowe albums, so in the end we’ve got about five album’s worth of Rockpile material. The tracks on wax were great, but live they were even better. Example wanted? ⇒Live at The Palladium in NYC,
Lowe’s first recording band was Kippington Lodge, of which I owned two singles. One of these was a German pressing with a picture sleeve, yet not showing the band. Then came Brinsley Schwarz and their „Silver Pistol“ album still holds a firm place on my record shelf. He was almost their sole song writer. After the Brinsleys Nick befriended Jake Riviera and so became house producer for Stiff Records. His productions are legendary, among them Elvis Costello and The Attractions. Lowe was producing for other labels too, for instance Graham Parker & The Rumour. He also was writing songs for other people (and for himself), and they were shimmering in Pop gold. He made a career for himself as a charming Pop singer with a number of chart entries. Yet he also could be a complete asshole – ask Dave Edmunds if you want to know. In “Cruel To Be Kind” all this is elaborated on as well as the time after Nick slowed down and became Pop’s grandad. His activities did not stop with old age, and he is still recording and performing.
For his Nick Lowe biography, Birch got many of Nick’s partners and fellow musicians on board to tell interesting stories galore and – despite Lowe’s reluctance to be interviewed – the book is full of first hand quotes of the master himself. “Cruel To Be Kind” is a wonderful read, once you have started you can’t stop.
PS: Nick Lowe debuted as a solo artist with a Garage Rock record. The B-side of which you can listen to somewhere else on this website.
BRIDGET ST. JOHN “Live at the Betsy Trotwood” 12” LP (Shagrat/Feeding Tube FTR474/ENT 024, 2019)
 Bridget St. John is now 70 years old, and nothing on this album does give it away. As a musician Bridget has often been subsumed under the term Folk, but it is not doing her justice as her songs are lacking the folkish essentials. She does not draw on typical Folk elements (and clichés), so I guess the term singer-songwriter is the more fitting one. “Live at the Betsy Trotwood” is Bridget’s 8th album over a period of 51 years. It was recorded live on 4th February 2017 and has now been issued by Shagrat in collaboration with Feeding Tube Records. If you dig expressive voices, vibrating like slow turning fans, and exquisite song writing this is the album for you. The word harmony is hovering over any of the songs performed. Sincerity is the term to characterize her songwriting. Bridget’s music is music to sit still to – and listen to. Once her expressive voice is wafting in the room there is no space for any negative vibrations. The room will soon be warm even in winter time with the heating turned off such is the atmosphere surrounding all her songs. Out of the nine songs on this album, seven have been penned by the lady herself and two are covers by kindred spirits Michael Chapman and Leonard Cohen. Ask me for a favourite track on this album and I would say “Lazarus”. “Live at the Betsy Trotwood” can be ordered directly from Shagrat.
Bridget St. John is now 70 years old, and nothing on this album does give it away. As a musician Bridget has often been subsumed under the term Folk, but it is not doing her justice as her songs are lacking the folkish essentials. She does not draw on typical Folk elements (and clichés), so I guess the term singer-songwriter is the more fitting one. “Live at the Betsy Trotwood” is Bridget’s 8th album over a period of 51 years. It was recorded live on 4th February 2017 and has now been issued by Shagrat in collaboration with Feeding Tube Records. If you dig expressive voices, vibrating like slow turning fans, and exquisite song writing this is the album for you. The word harmony is hovering over any of the songs performed. Sincerity is the term to characterize her songwriting. Bridget’s music is music to sit still to – and listen to. Once her expressive voice is wafting in the room there is no space for any negative vibrations. The room will soon be warm even in winter time with the heating turned off such is the atmosphere surrounding all her songs. Out of the nine songs on this album, seven have been penned by the lady herself and two are covers by kindred spirits Michael Chapman and Leonard Cohen. Ask me for a favourite track on this album and I would say “Lazarus”. “Live at the Betsy Trotwood” can be ordered directly from Shagrat.
MALCOLM MORLEY „Infinity Lake“ CD (Aurora AURMM1, 1919)
The guitarist and vocalist who helped to set up Help Yourself and lead them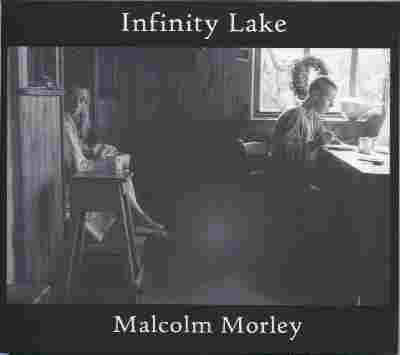 through 4 longplayers and later graced the boards of Bees Make Honey, Man, Deke Leonard’s Iceberg, The Tyla Gang and the Wreckless Eric band has now released a full CD of new songs. 10 tunes which “suggest vintage The Band or even Bob Dylan of Highway 61 Revisited” as Nigel Cross points out in his excellent liner notes – 10 superb songs drawing on American influences yet thoroughly British – 10 times laid-back yet grooving numbers that take you by the hand and lead you into a musical world seemingly long forgotten. This elegant organ and that sparse yet pithy guitar sure make my day. The variety of the tunes is stunning – without digressing from the prominent style. This sure is an excellent album which will range among those that you will always keep on the frontshelf. I hope there’s more to come. (See Malcolm and the Infinity Lake Band live at the Half Moon in Putney on February 16th.) The CD can be ordered directly from Aurora who also have a Starry Eyed And Laughing „Live at Rockpalast“ DVD for sale.
through 4 longplayers and later graced the boards of Bees Make Honey, Man, Deke Leonard’s Iceberg, The Tyla Gang and the Wreckless Eric band has now released a full CD of new songs. 10 tunes which “suggest vintage The Band or even Bob Dylan of Highway 61 Revisited” as Nigel Cross points out in his excellent liner notes – 10 superb songs drawing on American influences yet thoroughly British – 10 times laid-back yet grooving numbers that take you by the hand and lead you into a musical world seemingly long forgotten. This elegant organ and that sparse yet pithy guitar sure make my day. The variety of the tunes is stunning – without digressing from the prominent style. This sure is an excellent album which will range among those that you will always keep on the frontshelf. I hope there’s more to come. (See Malcolm and the Infinity Lake Band live at the Half Moon in Putney on February 16th.) The CD can be ordered directly from Aurora who also have a Starry Eyed And Laughing „Live at Rockpalast“ DVD for sale.
Wolfgang G. Müller und  Uwe Sandhop sind Veteranen der Berliner Musikszene. Den Wolfgang kennen wir von der Band THE ESCALATORZ (mit dem allseits beliebten H.P. Daniels), Uwe alias Sandy Hobbs war mit THE BEATITUDES und LES BLACK CARNATIONS Pionier der berliner Garage Rock und 60s Revival Szene. Zwei Burschen also, die sich um die Musik verdient gemacht haben. Nun haben die beiden mit drei weiteren Musikern als BEROLINA BIG BEAT QUARTETT drei elegante Surfnummern eingespielt. Der Clou ist, dass das Leadinstrument ein Mixturtrautonium ist, eine Weiterentwicklung des von Friedrich Trautwein 1930 entwickelten Trautoniums. Das Trautonium war der erste Synthesizer, ein Instrument, dass allein durch die Elektronik Töne erzeugte. In den 80er Jahren gab es einen modifizierten Nachbau durch Oskar Sala, das Mixturtrautonium. Die entstandenen Tonaufnahmen bestechen durch einen sehr eigenständigen, angenehmen Klang. Uwe Sandhop, über den die CD auch zu beziehen ist (udspost@web.de), hat mir dazu folgendes geschrieben:
Uwe Sandhop sind Veteranen der Berliner Musikszene. Den Wolfgang kennen wir von der Band THE ESCALATORZ (mit dem allseits beliebten H.P. Daniels), Uwe alias Sandy Hobbs war mit THE BEATITUDES und LES BLACK CARNATIONS Pionier der berliner Garage Rock und 60s Revival Szene. Zwei Burschen also, die sich um die Musik verdient gemacht haben. Nun haben die beiden mit drei weiteren Musikern als BEROLINA BIG BEAT QUARTETT drei elegante Surfnummern eingespielt. Der Clou ist, dass das Leadinstrument ein Mixturtrautonium ist, eine Weiterentwicklung des von Friedrich Trautwein 1930 entwickelten Trautoniums. Das Trautonium war der erste Synthesizer, ein Instrument, dass allein durch die Elektronik Töne erzeugte. In den 80er Jahren gab es einen modifizierten Nachbau durch Oskar Sala, das Mixturtrautonium. Die entstandenen Tonaufnahmen bestechen durch einen sehr eigenständigen, angenehmen Klang. Uwe Sandhop, über den die CD auch zu beziehen ist (udspost@web.de), hat mir dazu folgendes geschrieben:
„Schön, dass Dir die Aufnahmen gefallen. Ich denke, Du kennst auch das Original von „The Lonely Surfer“ von Jack Nitzsche?! Wolfgang G. Müller war Gitarrist der Berliner Band ROZZ (1979 bis 1983), die 1979 den 1. Preis beim 2. Pop-Nachwuchsfestival der Deutschen Phonoakademie in der Sparte Jazz erhielt und im Laufe ihres Bestehens zwei LPs bei der Teldec veröffentlichte. Wolfgang ist aber auch Sozialpädagoge. Etwa Mitte der 80er Jahre wurde er vom Bezirksamt Schöneberg von Berlin als Leiter eines Tonstudios (Musiklabor), welches das Bezirksamt in Kooperation mit der Berliner Kulturverwaltung (für die ich seit Dezember 1980 arbeite) betreibt, eingestellt. Seitdem haben wir beruflich miteinander zu tun. Wolfgang spielte aber auch weiterhin aktiv in diversen Bands, u.a. viele Jahre bei den ESCALATORZ. Auch hatte er ein eigenes Quartett. Ende der 90er, angestossen durch ein aus öffentlichen Mitteln gefördertes Projekt bzw. Stipendium, das Wolfgang technisch betreuen sollte, begann Wolfgang, sich dann auch für das Trautonium zu interessieren und ein eigenes Instrument originalgetreu nachzubauen. Es gab ja keines zu kaufen, nur Oskar Sala hatte weltweit das einzige spielbare Mixtur-Trautonium. Damals lebte Oskar Sala noch, und Wolfgang hatte Gelegenheit, bei ihm im Studio das Original-Trautonium zu vermessen und die genaue Konstruktion zu recherchieren. Die ganze Geschichte ist höchst spannend und leider viel zu lang, um sie hier auf die Schnelle zu erzählen. Die Surfmusik-Aufnahmen mit Trautonium sind, obwohl wir uns nun schon über 30 Jahre kennen und schätzen, unsere erste musikalische Zusammenarbeit. Eigentlich nennt er sich nur Wolfgang Müller. Das „G.“ steht für seinen zweiten Vornamen „Gerhard“. Zum einen hat er das G für die GEMA in seinen Namen eingefügt, zum anderen auch, um Verwechselungen mit einem anderen Berliner Musiker bzw. Künstler namens Wolfgang Müller zu vermeiden. Der war Kopf der Gruppe „Die Tödliche Doris“ (erste Hälfte der 80er Jahre), die zur Szene der „Genialen Dilletanten“ gezählt wurde.Bisher brenne ich Exemplare nur bei Bedarf. Mike Korbik, leider vor kurzem verstorben, und ich hatten ins Auge gefasst, davon vielleicht eine kleine  Auflage als Vinyl-Single oder EP pressen zu lassen. Mike wollte aktuelle Herstellungsmöglichkeiten recherchieren, da ich da keine Erfahrung habe bzw. Mike sich immer um solche Dinge gekümmert hat. Zudem war noch die Frage offen, wie das finanziert werden könnte. Daraus wird nun nichts. Ich bin aber in Kontakt mit Ronnie Rocket alias Ronnie Urini, ex-chlagzeuger bei THE VOGUE aus Wien. Der besucht öfters seinen alten Kumpel Paul Schwingeschlögel, Trompeter, hier in Berlin, mit dem ich mich durch unsere beruflichen Kontakte auch privat ein bisschen angefreundet habe. Ronnie ist schwer begeistert vom Trautonium und hat Wolfgang für eine Neuinterpretation der Titelmelodie von „Raumpatrouille“ angeheuert. Außerdem plant er, eine Vinyl-LP mit Musik aus Wien und Berlin herauszubringen, auf der auch das Berolina Big Beat Quartett vertreten sein soll. Der gute Ronnie sprudelt immer über vor Ideen. Im Augenblick hat er es mit dem Berliner Wannsee und möchte gern die „Berlin Beach Boys“ ins Leben rufen bzw. Aufnahmen machen, bei denen er wieder Schlagzeug spielen will, Paul und Wolfgang, diesmal an der Gitarre, sowie ich am Bass mitmachen sollen. Bei Ronnies Berlin-Besuch in diesem Sommer haben wir alle zusammen eine Dampferfahrt auf dem Wannsee gemacht und sind anschließend im Ausflugslokal „Blockhaus Nikolskoe“ eingekehrt.“
Auflage als Vinyl-Single oder EP pressen zu lassen. Mike wollte aktuelle Herstellungsmöglichkeiten recherchieren, da ich da keine Erfahrung habe bzw. Mike sich immer um solche Dinge gekümmert hat. Zudem war noch die Frage offen, wie das finanziert werden könnte. Daraus wird nun nichts. Ich bin aber in Kontakt mit Ronnie Rocket alias Ronnie Urini, ex-chlagzeuger bei THE VOGUE aus Wien. Der besucht öfters seinen alten Kumpel Paul Schwingeschlögel, Trompeter, hier in Berlin, mit dem ich mich durch unsere beruflichen Kontakte auch privat ein bisschen angefreundet habe. Ronnie ist schwer begeistert vom Trautonium und hat Wolfgang für eine Neuinterpretation der Titelmelodie von „Raumpatrouille“ angeheuert. Außerdem plant er, eine Vinyl-LP mit Musik aus Wien und Berlin herauszubringen, auf der auch das Berolina Big Beat Quartett vertreten sein soll. Der gute Ronnie sprudelt immer über vor Ideen. Im Augenblick hat er es mit dem Berliner Wannsee und möchte gern die „Berlin Beach Boys“ ins Leben rufen bzw. Aufnahmen machen, bei denen er wieder Schlagzeug spielen will, Paul und Wolfgang, diesmal an der Gitarre, sowie ich am Bass mitmachen sollen. Bei Ronnies Berlin-Besuch in diesem Sommer haben wir alle zusammen eine Dampferfahrt auf dem Wannsee gemacht und sind anschließend im Ausflugslokal „Blockhaus Nikolskoe“ eingekehrt.“
PS: The Escalatorz, The Beatitudes, Les Black Carnations und The Vogue wurden alle in hartbeat! ausgiebig portraitiert.
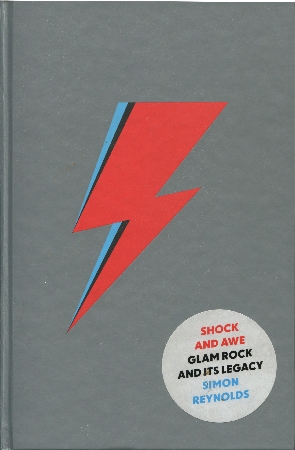 Simon Reynolds has written a book, „Shock And Awe – Glam Rock And Its Legacy From The Seventies To The Twenty-First Century” (Faber & Faber, 2016). My friend Uli gave this book to me as a present. Thanks, Uli. With over 650 pages it is good value for your money. But – as it goes with books – it’s not the size that matters, it’s the contents. Do I now know how to define Glam Rock? No! Obviously Glam Rock is more about visuals than anything else. Why would such a wimp like Marc Bolan go alongside heavies like Alex Harvey (by the way, his band was previously known as Tear Gas, not Gas Tank)? Bolan had got flashy clothes, Harvey had got Zal Cleminson in clown’s make-up.
Simon Reynolds has written a book, „Shock And Awe – Glam Rock And Its Legacy From The Seventies To The Twenty-First Century” (Faber & Faber, 2016). My friend Uli gave this book to me as a present. Thanks, Uli. With over 650 pages it is good value for your money. But – as it goes with books – it’s not the size that matters, it’s the contents. Do I now know how to define Glam Rock? No! Obviously Glam Rock is more about visuals than anything else. Why would such a wimp like Marc Bolan go alongside heavies like Alex Harvey (by the way, his band was previously known as Tear Gas, not Gas Tank)? Bolan had got flashy clothes, Harvey had got Zal Cleminson in clown’s make-up.
But then again it wasn’t about visuals, see Roxy Music or Suzi Quatro. Or The Heavy Metal Kids and The Runaways.
Whenever Jet is mentioned, I prick my ears, as Andy Ellison and David O’List have been favourites of mine since the mid-sixties. Would I call them Glam Rock? Definitely not. Yet seemingly everything goes from The New York Dolls to Hello, from Cockney Rebel to Alice Cooper. Even Nutz are mentioned who never dressed the style but recorded a nice Power Pop debut and two Hard Rock LPs afterwards. Iggy Pop, Alice Cooper, Mud, Sweet, Gary Glitter, Sparks, David Essex, Kraftwerk, Brian Eno, Queen even Be-Bop Deluxe are all thrown into the game until you are dizzy in the head. Yes, Wizzard was using make-up, and so was Kiss, but musically there were miles between them. And Doctors Of Madness never dressed according to Glam, but sported a violinist instead.
Quite a number of pages are – naturally – dedicated to David Bowie, and I feared the worst because Bowie has mostly been uncritically dealt with over the past years. People seem to have forgotten that Bowie aka Davy Jones was prone to fascist ideology and was a band breaker par excellence. Simon Reynolds puts his finger into the wound though. Thanks for that. And: I never liked pop stars who suffered from narcissistic personality disorder.
I enjoyed reading the book, as it offered me opportunities to delve into my record collection and pull out albums I hadn’t played for many moons. Yeah, I even got my Sparks albums out again, but found their Bearsville LPs underproduced and tinny in sound and the Island albums, though featuring Martin Gordon and/or Trevor White, sounding outdated these days. The Heavy Metal Kids sounded like they did in the mid-seventies. “Run Around Eyes” wasn’t exactly the Glam Rock prototype. And I also researched a bit and came across bands like Renegade, Iron Virgin, Hustler, Shelby, Daddy Maxfield, Kid Dynamite, Slow Bone, Streak, The Streakers, Bilbo Baggins, The Mob, Punchin’ Judy or Mabel who sounded real Glam rockin’ to me.
Now Simon Reynolds’ aim was to document Glam Rock’s legacy into the 21st century… he fails. If Kanye West, Beyoncé, Lady Gaga, Nicki Minaj and David Bowie (!!) are on his list for Glam Rock past the millinium… well!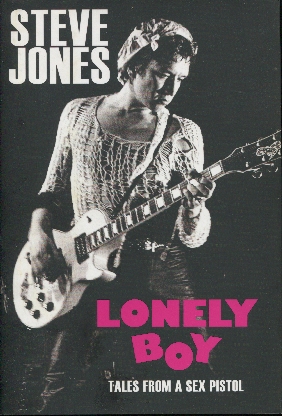
I’ve just finished Steve Jones’s autobiography „Lonely Boy – Tales from a Sex Pistol“ (co-written by Ben Thompson, Da Capo Press, 2017), and if David Crosby was bragging about his drug consumption, Billy Wyman about all the women he has been in bed with, Jones is bragging about his thievery. Goodness me, this guy nicked everything that wasn’t screwed to the floor… clothes, guitars, amps, bikes, you name it, he stole it! Even up to when he was in his 40s. He elaborates about his miserable childhood, his failure at school, but also about having enjoyed a relative freedom as a youngster. Of course, the intake of alcohol and drugs played a major role in his life as well and but sparingly only in this book. He doesn’t make any secret about always having been a male chauvinist, exploiting women without being willing to give. And do I really want to know about his masturbation techniques involving a hollowed-out loaf of bread and a half-pint of milk?! But I do want the Sex Pistols story told from a different point of view, and that is where he delivers. And I guess his story is the closest to the truth. That he’s no friend of John Lydon is obvious and understandable, but at the same time he calls him one of the greatest singers in Rock ‘n’ Roll. I can agree with that. I would have loved to read more details about Jonesy’s career post-Pistols with The Professionals, Chequered Past etc. But you can’t always get what you want. I’ve finished this book in two days, so you may guess it was a good read.
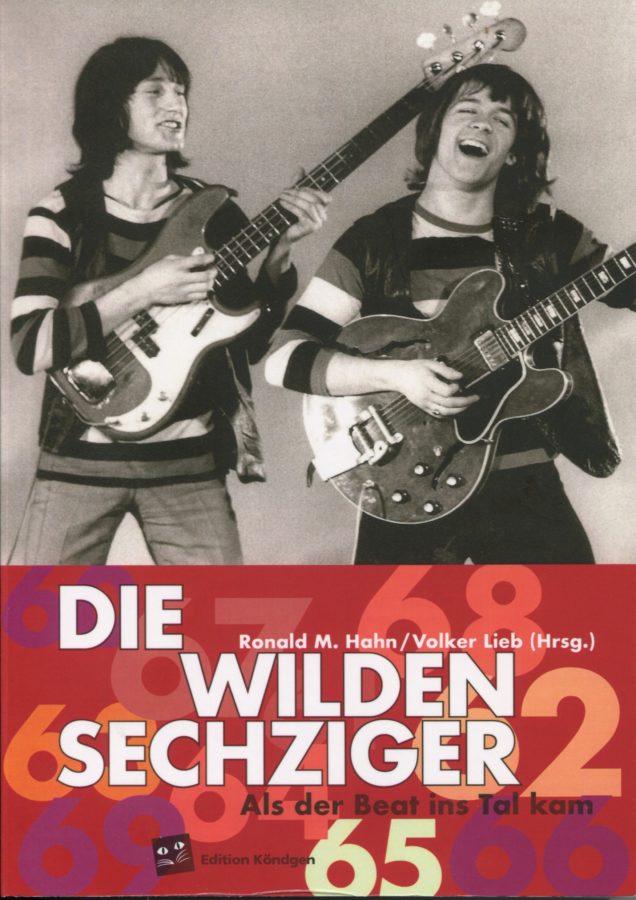
Die wilden Sechziger – Als der Beat ins Tal kam (Edition Köndgen ISBN 978-3-939843-86-3).
Ronald M. Hahn und Volker Lieb haben ein wunderschönes Buch über die Beatszene im längsten Dorf Deutschland herausgebracht. Nach einer Einführung in die Welt der 60er werden die wichtigsten 15 Beatgruppen aus Wuppertal vorgestellt, manche von diesen habe ich selbst live erlebt: The Consuls, The Liverpools, The Kentuckys 5 (im legendären Wilhelmsstübchen), The Rockets als Vorband zu The German Bonds oder The Beatkids als Vorgruppe zu The Pretty Things. Spielen konnten sie alle. Die Kentuckys waren natürlich die herausragenden Gesellen. Neben zwei Singles haben sie auch eine nicht-veröffentlichte LP eingespielt.
Hahn und Lieb können schreiben, doch wer was verfasst hat, wird nicht deutlich. Auch werden einige Namen als Kollaborateure aufgeführt, doch deren Rolle bleibt im Nebel. Die Bandgeschichten, mit Ausnahme der Geschichte der Mods, die etwas chaotisch und nur eingeschränkt nachvollziehbar ist, sind gelungen und abwechslungsreich. Auf den ersten 60 Seiten ist der Text jedoch gelegentlich bruchstückhaft und springend. Fast erscheint es, als seien die Autoren nach der Methode des stream of consciousness vorgegangen. Und so geraten denn auch chronologische Zusammenhänge gerne mal auseinander. Man schreibt über das Lennon-und-Ono-Album „Unfinished Music #1: Two Virgins“, erschienen im November 1968, um dann überzuleiten „Obwohl das Jahr 1968 vor der Tür steht…“ (S.53). Die Gründung von Apple (1968) erscheint in einem Kapitel, das sich mit 1966 auseinandersetzt.
Eine Reihe von Zeitungsausschnitten (S.30ff, S.40, S.130f), Äußerungen von Personen wie William Woodson (S.42) oder Listen von No. 1 Hits (S.43f, S.46f usw.) werden angeführt, doch werden sie nicht als Zitate ausgewiesen. Kleinere Sachfehler wie die Wahl zu den „Berliner Beatles“ (S.27) (es waren die „Deutschen Beatles“ im Star-Club Hamburg) oder die „Songs aus Liverpool“ (S.36) (es waren fast ausschließlich Coverversionen amerikanischer Veröffentlichungen) und Rechtsschreibfehler bei Bandnamen sind unerheblich.
Es erstaunt den Leser schon, wenn (offensichtlich) Ronald Hahn die von ihm an einigen Stellen im Buch geschmähten Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich in seine Liste der 60er Jahre Helden aufnimmt. Die Transzendentale Meditation zur Jugendbewegung zu erhöhen (S.53), ist schon seltsam. Auf die Wertung von bestimmten Bands möchte ich hier nicht eingehen, aber die Equals haben nicht nur „Diskogeblöke“ 6 von sich gegeben, sondern auch Songs wie „Police On My Back“, „Laurel and Hardy“, „Reincarnation“, „Lonely Rita“, „Black Skinned Blue Eyed Boys“, „Here Today, Gone Tomorrow“, „The Skies Above“ oder „Soulbrother Clifford“. Überhaupt scheint sich für Ronald H. (?) mit dem Ende der Beatära die populäre Rockmusik verabschiedet zu haben, aber danach ging es doch ab 1968 mit den großen Festivals und Rock als Massenphänomen weiter!
Die Bilder sind zum Teil sehr klein und nicht immer gut platziert (Bilder von 1962 im Text von 1968). Es wird auch nicht immer durch die Bildunterschrift deutlich, um welche Band es sich handelt. Aber dies ist jetzt wirklich Erbsenzählerei. Ich hätte mir allerdings mehr Betonung für die angesagten Gaststätten und Clubs in Wuppertal gewünscht, nicht nur die angeführten zwei. Es gibt auch Bilder von The Who. Die Bilder vom Konzert von The Who im Thalia Theater sind klein, und die Hälfte der Show fehlt. Vorgruppe waren die legendären John’s Children mit Marc Bolan an der Gitarre – nach dem Konzert in Ludwigshafen – zwei Auftritte später – flogen sie aus der Tour, weil sie den Who die Show stahlen/zu stehlen versucht hatten 7.
>>John’s Children „Go Go Girl“
Und dann sind da die Einlassungen von Gisela Bergmann – antiklimaktisch, denn die Gisela war ein angepasstes Dornröschen, das nicht aus dem Schlaf geholt wurde. Ein Interview mit einem Groupie (zumindest einem Beatgirl) hätte ich interessanter gefunden. Aber summa summarum ein Buch, das man als Fan der 60er unbedingt besitzen muss.
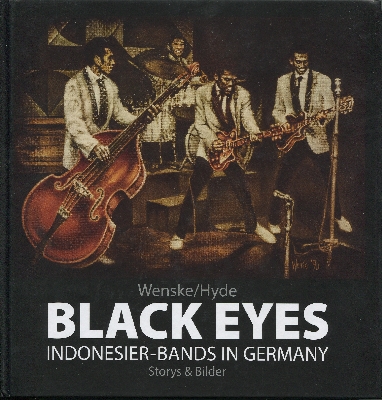 „Black Eyes“ (Hirnkost 2018, ISBN 978-3-945398-66-1)
„Black Eyes“ (Hirnkost 2018, ISBN 978-3-945398-66-1)
Helmut Wenske, alias Chris Hyde, hat wieder zugeschlagen. Herausgekommen ist eine 280-Seiten-Bibel über die Indo-Bands, wie sie sich in Deutschland in der 1. Hälfte der 60er Jahre tummelten – rockend, schmalzend, gelegentlich ein Mädel zum Anschaffen schickend. Da wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt – auch musikalisch. Das alles hat Wenske hautnah miterlebt und aufgeschrieben. Der Mann kann schreiben. Punkt. Dass er den schnodderigen Rock ’n‘ Roll-Ton trifft, hat er schon mit Büchern wie „Rock ’n‘ Roll Tripper“, „Rock ’n‘ Roll Tripper II“, „Fats And His Cats“ oder „Eastern Age“ bewiesen.
In diesem Buch dokumentiert Wenske die Bedeutung der Indo-Bands für die deutsche Musikszene nicht nur mit Liebe, sondern auch mit profundem Sachwissen. Bei ihm kann man sich darauf verlassen, dass es so war, wie er es aufgeschrieben hat, und auch kritische Distanz ist ihm nicht fern. Im ersten Teil des Buches geht Wenske auf die generelle historische Situation ein, dann stellt er ausführlich die wichtigsten und besten Indo-Bands vor: The Black Dynamites, The Black Magic, The Crazy Rockers, The Javalins, The Tielman Brothers (man beachte die alphabetische Reihenfolge!!).

Das Ganze ist garniert – nein, nicht garniert, es ist ja wie ein Hauptgericht – mit exquisitem, rarem historischem Bildmaterial: Eintrittskarten, Verträge, Zeitungsanzeigen, Zeitungsausschnitte, Plakate, Autogrammpostkarten, rare Plattencover, Bandfotos (live auf der Bühne, privat im Leben, im Fotostudio) sowie Fotos von den Clubs und Gaststätten, in denen die Bands auftraten. Und dass das Cover ein von Wenske gemaltes Bild der Tielman Brothers ziert, ist das Tüpfelchen auf dem i.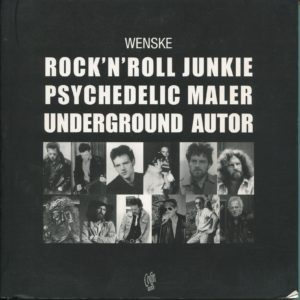 Dieses Buch gehört in jede Universitätsbibliothek unter die Fachbereiche Musik, Soziologie sowie Geschichte (der BRD). Und wer nun genauer wissen will, wer Helmut Wenske ist, dem empfehle ich die von ihm und anderen verfasste Biographie „Wenske – Rock’n’Roll Junkie, Psychedelic Maler, Underground Autor“ (CoCon Verlag ohne Jahr, ISBN 978-3-937774-64-0)
Dieses Buch gehört in jede Universitätsbibliothek unter die Fachbereiche Musik, Soziologie sowie Geschichte (der BRD). Und wer nun genauer wissen will, wer Helmut Wenske ist, dem empfehle ich die von ihm und anderen verfasste Biographie „Wenske – Rock’n’Roll Junkie, Psychedelic Maler, Underground Autor“ (CoCon Verlag ohne Jahr, ISBN 978-3-937774-64-0)
>>The Tielman Brothers „Love So True“
 Wolf-Dieter Straub hat seine Karriere als Plattenkäufer mit 13 begonnen: Peter Alexander “Delilah“! Das ist kein vielversprechender Anfang, doch irgendwie scheint er dann doch die Biege bekommen zu haben. Nun hat er ein 143 Seiten dickes Buch veröffentlicht: “Beat-Fieber zwischen Rhein und Neckar – Ein Streifzug durch die Szene der Rock’n’Roll- und Beat-Bands der 1960er Jahre im Raum Heidelberg-Mannheim“ (verlag regionalkultur, Heidelberg u.a.. 2019 – gekauft habe ich das übrigens schon 2018 – ISBN 978-3-95505-109-9).
Wolf-Dieter Straub hat seine Karriere als Plattenkäufer mit 13 begonnen: Peter Alexander “Delilah“! Das ist kein vielversprechender Anfang, doch irgendwie scheint er dann doch die Biege bekommen zu haben. Nun hat er ein 143 Seiten dickes Buch veröffentlicht: “Beat-Fieber zwischen Rhein und Neckar – Ein Streifzug durch die Szene der Rock’n’Roll- und Beat-Bands der 1960er Jahre im Raum Heidelberg-Mannheim“ (verlag regionalkultur, Heidelberg u.a.. 2019 – gekauft habe ich das übrigens schon 2018 – ISBN 978-3-95505-109-9).
Nach einer recht uninteressanten, vordergründigen Einleitung, in der die soziokulturellen und politischen Bedingungen nur rudimentär gestreift werden, arbeitet sich Straub an einer Vielzahl von Bands aus der Region ab. Seine Texte sind dabei gelegentlich etwas hölzern. “Beat-Fieber“ müsste sprachlich anders rüberkommen. Auch inhaltlich überzeugt das Buch nicht gerade durch Spritzigkeit. Überdies fehlt manchmal die inhaltliche Kohärenz (z.B. bei dem Eintrag für Nine Days Wonder). Die Artikel zu The Monks und The Tielman Brothers wirken aufgesetzt, vor allem da sie nur Bekanntes in verkürzter Form anbieten. Und dass Jimi Hendrix von Andy Tielman was abgeguckt hat, ist schlicht ein Märchen; er hat ihn nie getroffen.
Aber Straub hat sich mit diesem Buch ein echtes Fleißkärtchen verdient, denn die Bandgeschichten zusammenzutragen, ist mühevolle Kärrnerarbeit. Überragend ist die Vielzahl der Illustrationen: Eintrittskarten, Poster (leider zum Star-Club des fake aus den 70er Jahren mit dem 5-Zacken-Stern), Plattencover und Plattentüten, Autogrammpostkarten, Zeitungsausschnitte und massig Bandfotos. Zu den Zeitungsausschnitten hätte man sich bibliographische Angaben gewünscht, da hat der Stadtarchivdirektor, unter dessen Leitung das Buch entstanden ist, seine Augen nicht offen gehabt.
Das Buch ist als Sonderveröffentlichung 23 in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Heidelberg entstanden. Für Layout zeichnet eine Dame verantwortlich, aber dem Stadtarchivdirektor Dr. Peter Blum ist wohl der Hauptvorwurf zu machen. Es ist schändlich wie in diesem Buch mit historischem schwarz-weißem Bildmaterial umgegangen wird: da werden nicht nur Bilder freigestellt und mit einem verlaufenden Rahmen in Orange versehen; es werden auch Fotos farbig überdruckt oder mit einem farbigen Verlauf versehen – immer mit einem schmuddeligen Orange! Da werden historische Plakate farbig (orange, natürlich) aufgehübscht; da werden Schriften auf Postkarten oder Bassdrums plötzlich farbig (den Farbton kann sich jeder denken). Moderne PC-Schrift wird in historische Fotos einkopiert, der Hintergrund im Foto der Junior Rockets wird mit einem Sternchenmuster (!) dekoriert. Selbst die Fotos bei den Tageszeitungsausschnitten werden farbig hinterlegt. Manches ist einfach nur grausam anzusehen, und wer den Tick mit dem Orange hatte, gehört eh auf einen anderen Arbeitsplatz. Aber Herr Stadtarchivdirektor Dr. Peter Blum, so darf man historisches Bildmaterial nicht verstümmeln!
Auch an der Bergstraße, einer langgezogenen Region von Hessen nach Baden-Württemberg, wurde beatmäßig den Altvorderen der Marsch geblasen. Und zwar kräftig. Wir bewegen uns zwischen Einhaus, Zwingenberg (Heimstadt der „wildesten Beatband Hessens“), Bürstadt, Weinheim, Bensheim, Ober-Mumbach, Heppenheim, Reichenbach, Laudenbach, aber auch Darmstadt und Heidelberg.
 Dann erschien 2017 ein Buch dazu, um alles zu beweisen: “Als der Beat an die Bergstraße kam – Zeitgefühl – Bands – Geschichten der 60er-Jahre“ (Edition Ralf Farzer, Edingen-Neckarhausen, ISBN 978-3-940968-33-3) – kurzum, ein Titel, der nicht gerade den Beat hat. Autor Ernst-Ludwig Drayß, im Vorwort abgebildet, schaut so erzkonservativ aus, dass er wohl selbst beim Vorstellungsgespräch für einen Finanzamtsjob keine Chance gehabt hätte. Und so schreibt er oft auch: “Für die „Teenager“ in den 60er Jahren war der Besuch einer „Tanzstunde“ ein Muss. Mit 17 Jahren war es dann auch bei mir so weit, wobei fast alle meiner Klassenkameraden schon ihren „Abschlussball“ erlebt hatten. Ich war bei den Nachzüglern.“ Nun, das mag an der Bergstraße so gewesen sein, ich und meine gesamte Clique waren nicht in der Tanzstunde… und wieso stehen da so viele Anführungszeichen. War die Tanzschule nur ein getarnte?
Dann erschien 2017 ein Buch dazu, um alles zu beweisen: “Als der Beat an die Bergstraße kam – Zeitgefühl – Bands – Geschichten der 60er-Jahre“ (Edition Ralf Farzer, Edingen-Neckarhausen, ISBN 978-3-940968-33-3) – kurzum, ein Titel, der nicht gerade den Beat hat. Autor Ernst-Ludwig Drayß, im Vorwort abgebildet, schaut so erzkonservativ aus, dass er wohl selbst beim Vorstellungsgespräch für einen Finanzamtsjob keine Chance gehabt hätte. Und so schreibt er oft auch: “Für die „Teenager“ in den 60er Jahren war der Besuch einer „Tanzstunde“ ein Muss. Mit 17 Jahren war es dann auch bei mir so weit, wobei fast alle meiner Klassenkameraden schon ihren „Abschlussball“ erlebt hatten. Ich war bei den Nachzüglern.“ Nun, das mag an der Bergstraße so gewesen sein, ich und meine gesamte Clique waren nicht in der Tanzstunde… und wieso stehen da so viele Anführungszeichen. War die Tanzschule nur ein getarnte?
Drayß kann es aber auch besser, und so sind manche Passagen recht eloquent. Er weiß interessante Anekdoten zu erzählen. Leider missrät ihm immer wieder etwas: da zitiert er oberflächlich erstellte Wikipedia-Einträge, da schreibt er durchgängig „psychodelisch“ (statt psychedelisch) oder „Starclub“ (statt Star-Club – aber immerhin hat er das richtige Plakat als Illustration – 6-Zacken-Stern-Poster!!). Der Parka wird bei ihm zum „Parker“, die Beatles waren bereits 1965 auf Deutschland-Tournee, usw. Auf Seite 23 sind die Beatles dann schon 1964 auf Tournee, man interviewt einen Beatles-Jünger vor der Festhalle (?). Der Inhalt dieses Interviews ist Stuss, und so etwas darf man für ein seriöses Buch nicht übernehmen. Grau unterlegte Flächen sollen Definitionen und Erläuterungen liefern, diese sind aber oft durch Vorurteile geprägt oder schlichtweg Bla-Bla, z.B. zum Thema Mods vs. Rocker. Das Problem der Teddy Boys gab es 1966 in Deutschland nicht, auch habe ich damals keine Vespas auf deutschen Straßen gesehen. Ein mit der Zeitgeschichte vertrauter Lektor hätte all diese Ungereimtheiten bemerkt.
Auch wenn es manchmal etwas holprig klingt, wenn Drayß Aussagen von Musikern 1 zu 1 übernimmt, ist dies ein Buch, das andere Bücher zu regionalen Beatszenen übertrifft. Manche Aussagen von Zeitzeugen hätten allerdings der Redaktion bedurft: 1966 gab es noch keine „Hippies“ (S. 77) oder bei Horst Schleißmanns Ausführungen wären die „abgesenkten“ Haare aufgefallen.
Zum Abschnitt über Rock ‘n‘ Roll verwendet Drayß leider Fotos von späteren Rock ‘n‘ Roll Revivals. Dann verweist er auf Fotos (S.85), wo die Jugendlichen angeblich wie Mods gekleidet sind; de facto sehen sie aus wie Konfirmanden. Drayß will einfach zu viel, er schreibt über Dinge, von denen er keine Ahnung hat, und so ist das Kapitel “Vom Beat zu „Revolution““ (S.55) einfach nur Blödsinn, ebenso die auf S. 86 angeführten Zitate. Wer da zitiert wird, wird nicht genannt – und es wird reaktionäres Zeug wiedergegeben und der Verlust des deutschen Volkslieds beklagt: “Kein schöner Land“. Wie nun der (ebenso reaktionäre) 70er-Jahre-Song “Sweet Home Alabama“ da rein passt, weiß wohl nur der Autor, dessen unbekannte Quelle jährlich an Pfingsten wieder Beatsongs gröhlt (ja, das steht da wirklich), statt “Wildgänse rauschen durch die Nacht zu singen“, was er viel lieber täte, aber sein eigener Opportunismus steht ihm im Wege.
Da Drayß versucht, so viele wie möglich von den alten Kämpen zu Wort kommen zu lassen, sind viele Aussagen arbiträr, banal und redundant. Da muss der Autor filtern. Das Nachwort von Raymund Müller ist so ein Beispiel (S. 114f). Da kräuseln sich einem die (sprachlichen) Nackenhaare. Und jede Bandstory (die ähneln sich doch alle sowieso) bis ins letzte Detail auszuwalzen, bringt es nicht. Aber so kommt man auf 256 Seiten.
Die bekannteste Band aus der Region waren The Reacers. Und die bekommen den verdienten Raum. Meine nicht gerade positive Rezension ihrer Schallplatte in “Shakin‘ All Over“ wird zitiert.
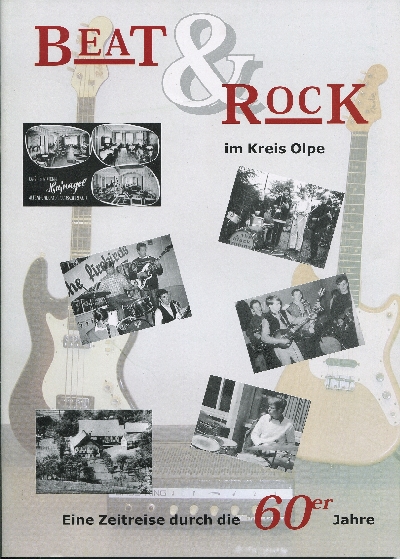 Autokennzeichen OE. Nun, wo sind wir? Auswärtige nennen sie gerne humorig “die Ölper“, wegen des Kfz-Kennzeichens, aber natürlich sind sie “die Olper“, jene Menschen aus Olpe. Ja, auch zwischen den nebelverhangenen Bergen des Ebbe- und Rothaargebirges, des südlich angrenzenden Siegerlandes, kurzum im finstersten Sauerland, wollten Jungspunde den Altvorderen den Hammer zeigen und mit Lärm, Uffta und Getrommel auf sich aufmerksam machen. Klar, die Region hat keine Stars hervorgebracht, aber auch The Black Rubins oder The Firebirds können genug Radau machen, um für gesegneten Freizeitspaß für die lokalen Jünger zu sorgen. Gerd Schauerte, wohnhaft in Lennestadt-Meggen, hat sich hingesetzt und einiges in die Tastatur gehauen. So kam es zu dem 80-Seiten-DIN-A4-Büchlein “Beat & Rock im Kreis Olpe – Eine Zeitreise durch die 60er Jahre“ (2006, keine Verlagsangabe, keine ISBN-Nummer). Völlig unorthodox in der inhaltlichen Konzeption, ist Schauerte ein kleines Juwel gelungen, denn hier wird Beatprovinz und Epigonentum veranschaulicht, wie es schöner nicht hätte gelingen können. Alles wird von einer Aura der Arglosigkeit, der Unschuld umrankt… und die Fotos spiegeln genau dies wieder. Das Büchlein ist nicht zum Standardwerk der Beatgeschichte geeignet, es ist eine kleine, funkelnde Facette aus dem Land der Träume. Weit weg von den Metropolen.
Autokennzeichen OE. Nun, wo sind wir? Auswärtige nennen sie gerne humorig “die Ölper“, wegen des Kfz-Kennzeichens, aber natürlich sind sie “die Olper“, jene Menschen aus Olpe. Ja, auch zwischen den nebelverhangenen Bergen des Ebbe- und Rothaargebirges, des südlich angrenzenden Siegerlandes, kurzum im finstersten Sauerland, wollten Jungspunde den Altvorderen den Hammer zeigen und mit Lärm, Uffta und Getrommel auf sich aufmerksam machen. Klar, die Region hat keine Stars hervorgebracht, aber auch The Black Rubins oder The Firebirds können genug Radau machen, um für gesegneten Freizeitspaß für die lokalen Jünger zu sorgen. Gerd Schauerte, wohnhaft in Lennestadt-Meggen, hat sich hingesetzt und einiges in die Tastatur gehauen. So kam es zu dem 80-Seiten-DIN-A4-Büchlein “Beat & Rock im Kreis Olpe – Eine Zeitreise durch die 60er Jahre“ (2006, keine Verlagsangabe, keine ISBN-Nummer). Völlig unorthodox in der inhaltlichen Konzeption, ist Schauerte ein kleines Juwel gelungen, denn hier wird Beatprovinz und Epigonentum veranschaulicht, wie es schöner nicht hätte gelingen können. Alles wird von einer Aura der Arglosigkeit, der Unschuld umrankt… und die Fotos spiegeln genau dies wieder. Das Büchlein ist nicht zum Standardwerk der Beatgeschichte geeignet, es ist eine kleine, funkelnde Facette aus dem Land der Träume. Weit weg von den Metropolen.
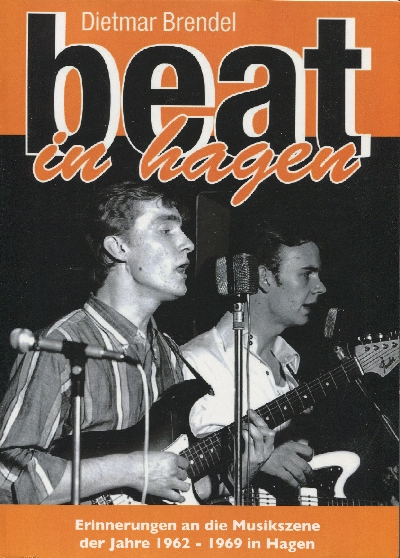
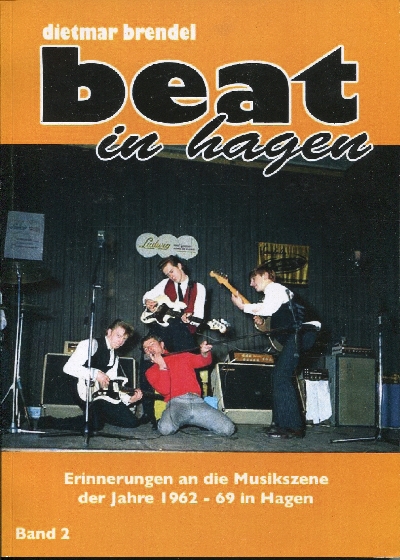
Dietmar Brendel „Beat in Hagen“ und „Beat in Hagen Band 2“ (Eigenverlag)
Dietmar Brendel ist hier gleich mit zwei Büchern am Start. Vor ein paar Jahren verfasste er ein Buch über die Hagener Beatszene, und er zeigte damit, dass Hagen auch vor Extrabreit und Nena bereits musikalisch eine Hochburg in Westfalen war. Wie es so ist, kommen nach einem Buch die Eichhörnchen aus ihren Bauten und schleppen Futter an, mit dem man nicht gerechnet hat. Und schon hat man einen zweiten Band zu schreiben. So war es auch hier.
Band 1 ist mittlerweile in der 4. Auflage erschienen, so begehrt ist das Buch, und es ist jeden Pfennig wert. In klarer Sprache legt Brendel auf 200 Seiten die Beatgeschichte der Stadt Hagen dar, und gelegentlich schaut er auch über den Tellerrand hinaus. Das Buch ist gespickt mit akkuraten Informationen über die angetretenen Bands und die Auftrittsmöglichkeiten. Obwohl wir als Gevelsberger und Schwelmer Teens eher in Richtung Wuppertal und Düsseldorf orientiert waren, sind mir einige der Orte gut bekannt. Vom Jugendheim in Hagen-Haspe über das Jugendheim am Buschey, dem Pferdestall in der Nähe des Bahnhofs bis zum Eppenhauser Brunnen u.a. haben wir nicht nur Hagener Bands hören können. Viele Namen im Buch sind mir noch gut geläufig, und bei einigen der beschriebenen Veranstaltungen war ich anwesend.
Brendel hat einen Haufen an Fakten zusammengetragen, aber das Unwiderstehliche an diesem Buch sind die Illustrationen. Unglaublich, was Brendel da aufgetrieben hat: von der Eintrittskarte über Verträge, Handzettel, Zeitungsausschnitte, Flyer und Poster bis hin zu Werbematerial und einer nicht enden wollenden Kette von Bandfotos. Und dann kommt Brendel mit einem 2. Band nach – noch einmal 140 Seiten in der Qualität von Band 1, zwölf Bands und allerlei 60s Relevantes wird nachgereicht. Respekt. Ach so, Brendel war selbst Schlagzeuger in einer Beatband in Hagen, und er inspirierte seinen Bruder Rolf, das Instrument auch zu erlernen. Wo der dann musikalische gelandet ist, dürft ihr selber rausfinden.
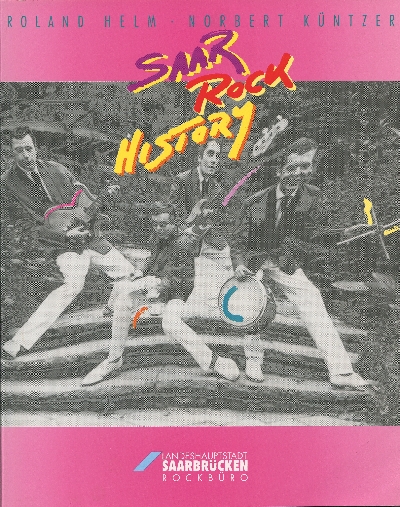
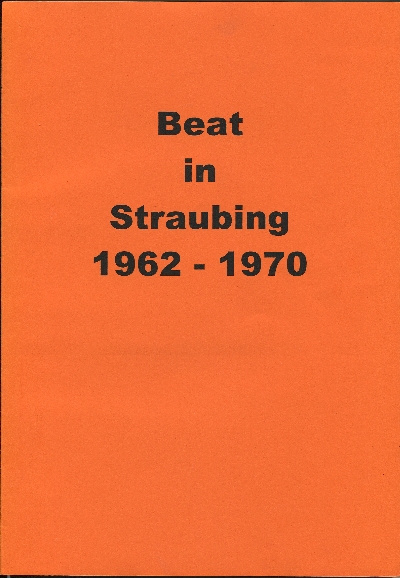
Bereits 1991 erschien “Saar Rock History” von Roland Helm und Norbert Küntzer im Buchverlag Saarbrücker Zeitung (ISBN 3-922807-42-9) unter der Schirmherrschaft des Rockbüros der Landeshauptstadt Saarbrücken. Hier werden die Musikszenen von den 50ern bis 1990 beleuchtet, Beat-mäßig werden Frankie Farians Die Schatten, The Blackbirds, The Starfighters und The Nightbirds (die so tolle Uniformjacken hatten – aus dem Bergbau?) herausgehoben. Viele andere Bands werden am Rande erwähnt. Dann sind wir auch schon bei Oxymoron und Dies Irae und verlassen die 60er. Natürlich ist das Buch bebildert, aber in diesem Bereich sind Ihnen andere Bücher weit voraus.
“Beat in Straubing 1962 – 1970” ist allein eine Sammlung von Zeitungsanzeigen zu Beatveranstaltungen in Straubing. Ohne Erscheinungsjahr, ohne Verlag, ohne Urheberangabe. Bilder gibt es auch keine. Ob die Anzeigen in Richtung Vollständigkeit gehen, kann ich nicht beurteilen, jedenfalls ist die Anzahl groß. Das Interessante ist, dass sich bei Durchsicht der Anzeigen ein Bild über die Beatszene in Straubing ergibt. Adverts say more than words in this case.
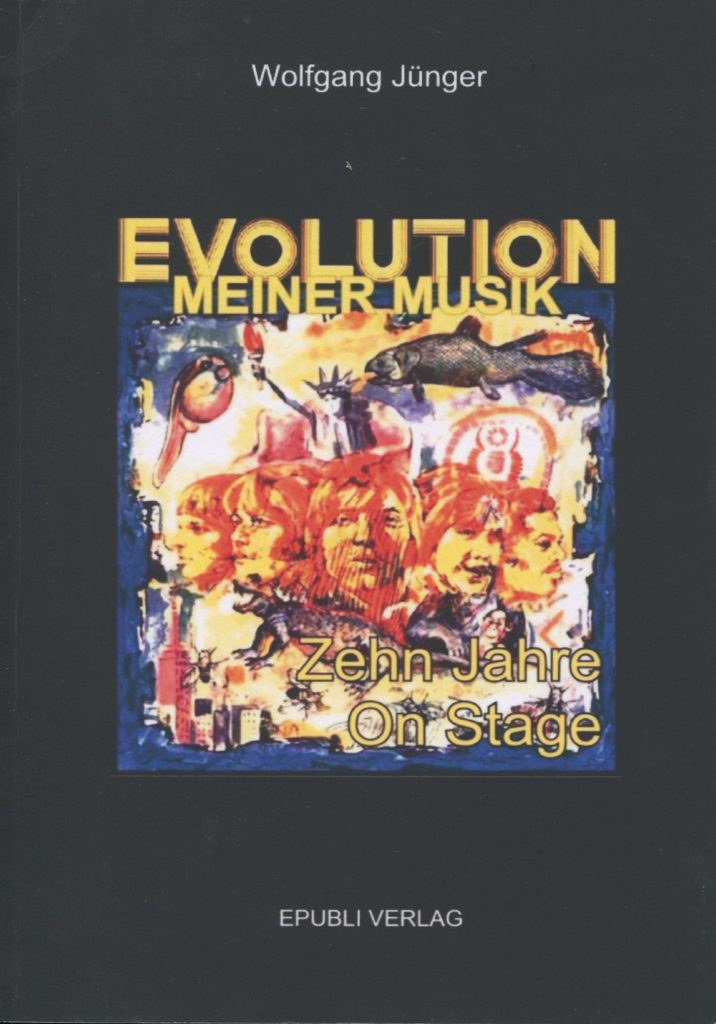 Wolfgang Jünger, now sporting a very white moustache, had had about 10 years in Rock business, most of them in Spain where his band was quite popular. They originally hailed from Schweinfurt, cut into the Frankfurt Beat scene before moving off to Spain – a country that was then governed by dictator Franco. They – The Vampires – lived there quite unmolested, due to their ability to travel under the radar. Well, they were generally nice guys (apart from the odd guy temporarily in the band) – they didn’t upskirt any Spanish girls then or behave conspicuously. „Evolution meiner Musik“ (Epubli Verlag, Berlin, 2012, ISBN 978-3-85442-3694-1) tells about all those years from 1962 (when Wolfgang was incited) to 1972, when the whole trip came to a halt and his band – now a (medium) Progressive Rock band called Evolution – dissolved. Jünger didn’t live the life of Sex And Drugs And Rock ’n‘ Roll – he didn’t smoke any hash, he didn’t down any LSD, he didn’t even drink more than the odd pint. If all Rockstars were like him, the world would be a poorer place. He dutifully served in the German army and was positive about it. As a conscientious objector and a determined pacifist, I cannot share his attitude towards any kind of military service. But that is another story. „Evolution meiner Musik“ did not really rock me. There was no Rock ’n‘ Roll in the writing, as Wolfgang Jünger is a conservative at heart. I bet that he votes for the CSU.
Wolfgang Jünger, now sporting a very white moustache, had had about 10 years in Rock business, most of them in Spain where his band was quite popular. They originally hailed from Schweinfurt, cut into the Frankfurt Beat scene before moving off to Spain – a country that was then governed by dictator Franco. They – The Vampires – lived there quite unmolested, due to their ability to travel under the radar. Well, they were generally nice guys (apart from the odd guy temporarily in the band) – they didn’t upskirt any Spanish girls then or behave conspicuously. „Evolution meiner Musik“ (Epubli Verlag, Berlin, 2012, ISBN 978-3-85442-3694-1) tells about all those years from 1962 (when Wolfgang was incited) to 1972, when the whole trip came to a halt and his band – now a (medium) Progressive Rock band called Evolution – dissolved. Jünger didn’t live the life of Sex And Drugs And Rock ’n‘ Roll – he didn’t smoke any hash, he didn’t down any LSD, he didn’t even drink more than the odd pint. If all Rockstars were like him, the world would be a poorer place. He dutifully served in the German army and was positive about it. As a conscientious objector and a determined pacifist, I cannot share his attitude towards any kind of military service. But that is another story. „Evolution meiner Musik“ did not really rock me. There was no Rock ’n‘ Roll in the writing, as Wolfgang Jünger is a conservative at heart. I bet that he votes for the CSU.
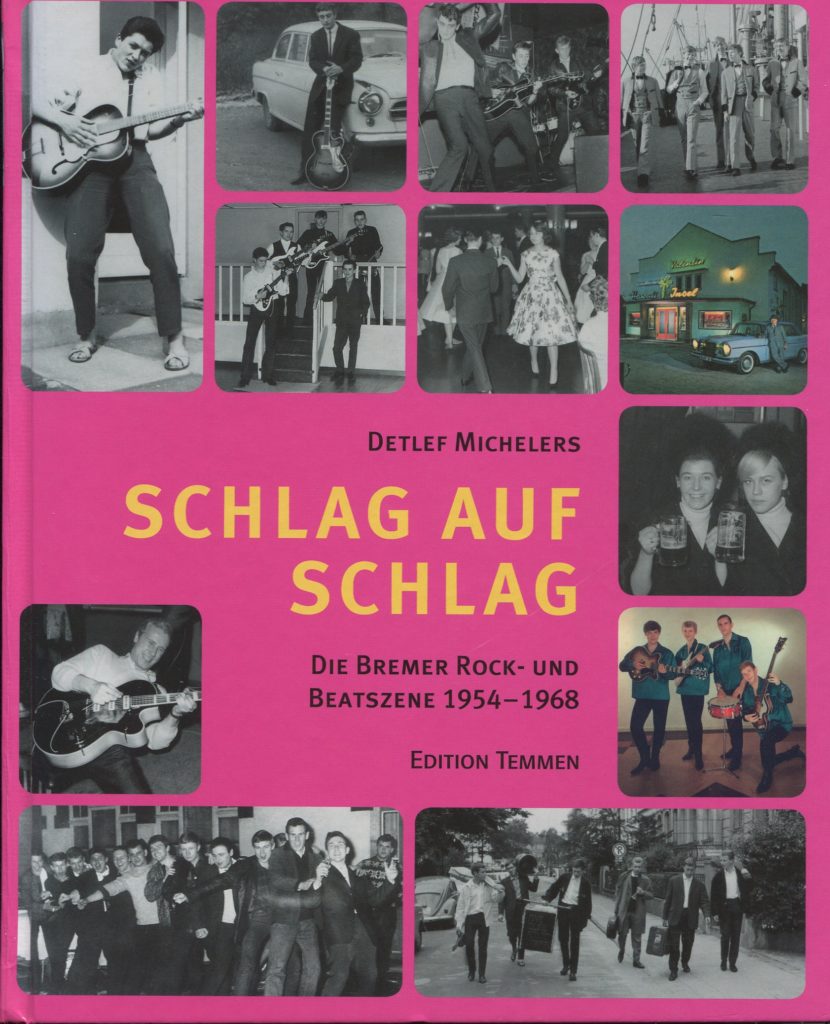 2010 erschien in der Edition Tammen “Schlag auf Schlag – die Bremer Rock- und Beatszene 1954 – 1968” von Detlef Michelers (ISBN 978-3-8378-1017-2). Über die Rock ‘n‘ Roll und die Skiffle-Bands arbeitet sich Michelers zu den Beatbands vor, und denen gibt er gewaltig Raum (fast 200 der insgesamt fast 250 Seiten ist den Beatjahren gewidmet). Dabei werden besonders die bekannten Bands wie Die Yankees, The Mushroams, The Germans oder The Happy Times hervorgehoben. Die zweite und dritte Liga taucht dann im Bandverzeichnis auf. Angereichert ist das Buch mit 386 Abbildungen. Eine optische Fundgrube in der Tat – und ein Fleißkärtchen für die Recherche. Sprachlich ist das Buch eher bieder – na ja, mehr als bieder – aber das ist bei ungeübten Autoren zu erwarten.
2010 erschien in der Edition Tammen “Schlag auf Schlag – die Bremer Rock- und Beatszene 1954 – 1968” von Detlef Michelers (ISBN 978-3-8378-1017-2). Über die Rock ‘n‘ Roll und die Skiffle-Bands arbeitet sich Michelers zu den Beatbands vor, und denen gibt er gewaltig Raum (fast 200 der insgesamt fast 250 Seiten ist den Beatjahren gewidmet). Dabei werden besonders die bekannten Bands wie Die Yankees, The Mushroams, The Germans oder The Happy Times hervorgehoben. Die zweite und dritte Liga taucht dann im Bandverzeichnis auf. Angereichert ist das Buch mit 386 Abbildungen. Eine optische Fundgrube in der Tat – und ein Fleißkärtchen für die Recherche. Sprachlich ist das Buch eher bieder – na ja, mehr als bieder – aber das ist bei ungeübten Autoren zu erwarten.
Ralf Frö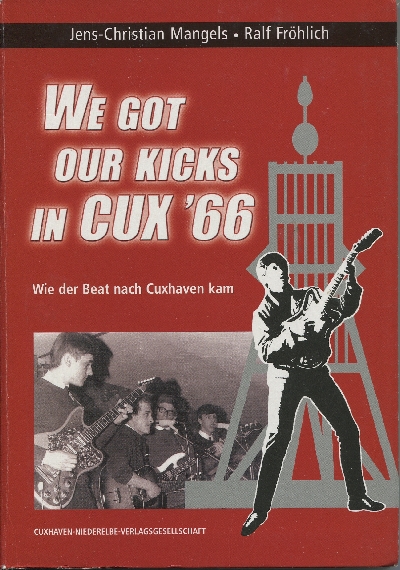 hlich und Christian Mangels sind solide Schreiberlinge, und das merkt man dem Buch “We got our kicks in Cux ’66 – Wie der Beat nach Cuxhaven kam“ an. Das Buch fußt auf gründlicher Recherche und überzeugt mit vielfältigem, exquisitem Bildmaterial.
hlich und Christian Mangels sind solide Schreiberlinge, und das merkt man dem Buch “We got our kicks in Cux ’66 – Wie der Beat nach Cuxhaven kam“ an. Das Buch fußt auf gründlicher Recherche und überzeugt mit vielfältigem, exquisitem Bildmaterial.
In “Cux ‘66“ schauen die Autoren auch über den Tellerrand hinaus, und so bekommen wir auch internationale Künstler in Zusammenhang mit Cuxhaven angeboten. Insgesamt ein klasse Buch, das ich immer wieder gerne zur Hand nehme. Hier werden sprachlich glatt und inhaltlich klar die wichtigsten Bands aus Cuxhaven vorgestellt. Störend und überflüssig sind allein die zahlreichen Selbstbeweihräucherungen durch Fotos von vornehmlich Ralf Fröhlich neben den gealterten Heroen und die handschriftlichen Grußbotschaften auf Zetteln à la “Dear Ralf all the best for the Cux 66 Project. Good Luck and Much Success. Yours Lee Curtis“ oder “Our thanks to Germany and Cux-66, without you Merseysound would not Exist King Size Taylor“. Of course, it would. Cux was not the centre of the Beat world. So… why such a bullshit?!?!

Ein echtes Diadem ist “Club E. Beat, Bier und Beischlafköfferchen“ von Nadine Beck, erschienen 2011 als Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur Band 97 (ISBN 978-3-923820-97-9). Der Untertitel ist ein treffender: “Ein ethnologischer Streifzug durch Marburg im Jahre 1966“. Dabei eröffnet Nadine Beck diesen Band mit einem Porträt der Bundesrepublik im Jahre 1966, bevor sie auf ihr eigentliches Thema eingeht.
Das Buch ist in dreifacher Hinsicht einmalig. Erstens ist es das einzige Buch zur Beatära, das von einer Frau geschrieben wurde, zweitens ist die Autorin Kulturwissenschaftlerin und weiß, wie man kulturhistorische Themen angehen muss, und drittens ist es m. W. das einzige deutsche Buch, das sich ausschließlich einem Provinz-Club widmet. Nadine Beck weiß, worüber sie schreibt, sie hat profundes Wissen und kann dieses angemessen und oft humorvoll versprachlichen. Ihr Bildmaterial ist großartig, und sie macht uns die Beteiligten in ihren menschlichen Facetten lebendig. Mit diesem Buch befördert sie den Leser zum Teilhaber an einer ganz besonderen Geschichte. Für mich war die Lektüre ein großes Vergnügen.
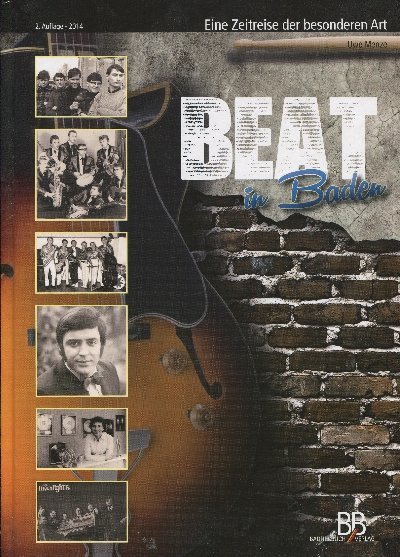 Uwe Menze, Schnauzbartträger aus Muggensturm, führt das Rocking-Stars-Archiv; er hat mir mal mit Informationen geholfen, daher kenne ich ihn. Er ist erst spät zu der Materie gestoßen, über die er in “Beat in Baden“ (BadnerBuch-Verlag, 2014, ISBN 978-3-944635-05-7) schreibt, aber er hat sich eine Menge draufgeschafft, wie man das so beatzeitlich musikermäßig nennt. Natürlich ist es kein kluger Schachzug, ein Buch über die Beatära mit einem Vorwort von Tony Marschall zu beginnen, mag er auch noch so gerne Einlagen bei den Beatbands gesungen haben. Es ist dann schon witzig, wenn Menze uns erklärt, dass die Melodie von “Schöne Maid“ “ursprünglich ein Traditional der Maori aus Neuseeland“ sei.
Uwe Menze, Schnauzbartträger aus Muggensturm, führt das Rocking-Stars-Archiv; er hat mir mal mit Informationen geholfen, daher kenne ich ihn. Er ist erst spät zu der Materie gestoßen, über die er in “Beat in Baden“ (BadnerBuch-Verlag, 2014, ISBN 978-3-944635-05-7) schreibt, aber er hat sich eine Menge draufgeschafft, wie man das so beatzeitlich musikermäßig nennt. Natürlich ist es kein kluger Schachzug, ein Buch über die Beatära mit einem Vorwort von Tony Marschall zu beginnen, mag er auch noch so gerne Einlagen bei den Beatbands gesungen haben. Es ist dann schon witzig, wenn Menze uns erklärt, dass die Melodie von “Schöne Maid“ “ursprünglich ein Traditional der Maori aus Neuseeland“ sei.
Auf 165 Seiten im Großformat beschreibt Menze – sprachlich etwas sperrig – die Rastatter Musikszene der 60er. Er hat viel Bildmaterial zusammengetragen, wobei vor allem jenes überzeugt, das sich den lokalen Bands widmet. Da wird dann Badener Beatgeschichte greifbar, nicht bei den Plattencovern der Lords, Rolling Stones, Shadows et al., den Annoncen für den Star-Club Bielefeld oder der Abbildung des Schlagerbuchs 2 vom Bastei-Verlag. Neben den einschlägigen Beatbands – The Rocking Stars bekommen natürlich viel Raum (inkl. Einzelstories über Ricky King, Pete Tex, Gerd Köthe) – unterhält uns Menze (mehr oder weniger) mit Geschichten über Künstler wie Joe Raphael, Kurt Götze, Los Eldorados, Die Skippies, Peter Griffin, Die Flippers… interessant für den Beatfan wird es bei The Ghostmen, The Firestones, Die Beathovens, Lonley [sic!] Stars, The Sunbeams, The Moonlights, The Starfighters.
Zwei Bücher die mir sehr gefallen haben:
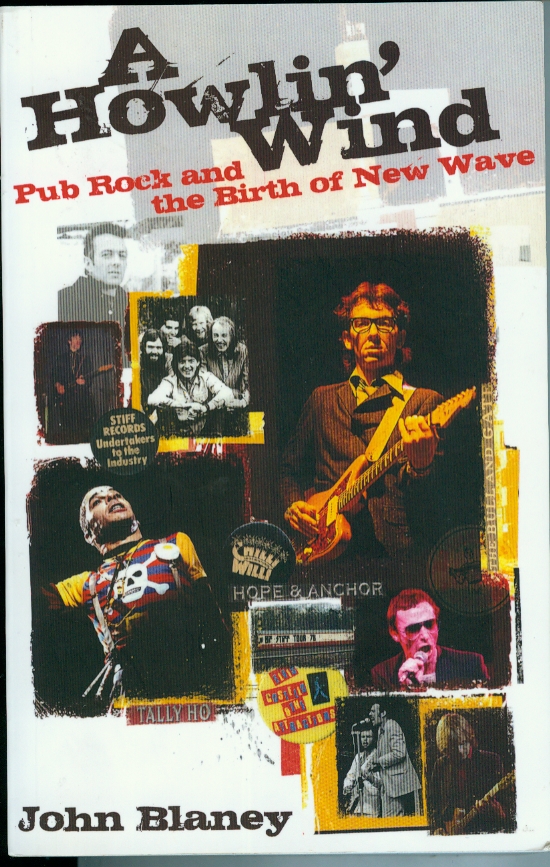
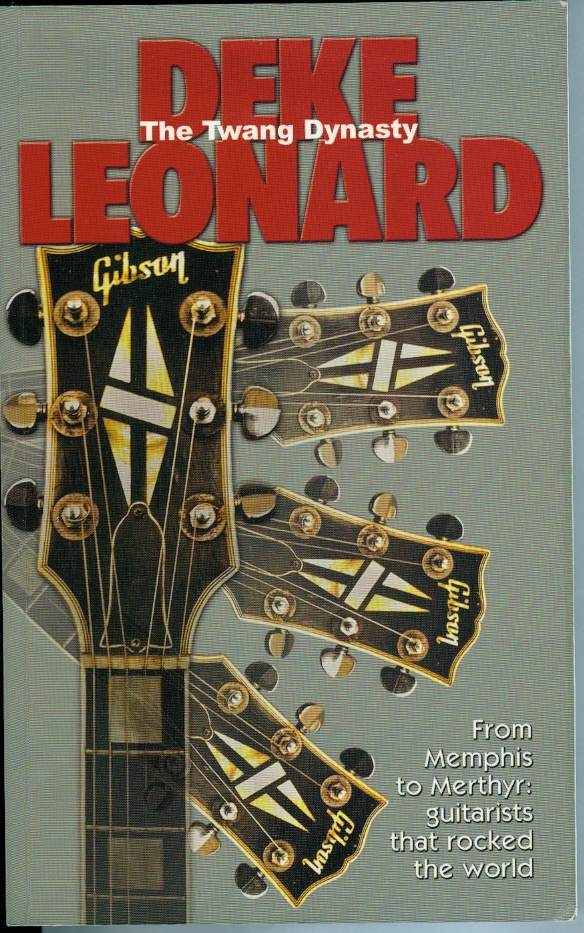
Zappa, Zoff und Zwischentöne“ ist ein wichtiges Buch, denn es arbeitet zum ersten Mal die Internationalen Essener Songtage von 1968 auf und dokumentiert diese für die Nachwelt. Illustriert ist das Buch durchgängig mit interessanten Fotos vom ersten deutschen Rock- und Songfestival. Leider ist der Autor ein blasierter Studiendirektor a.D., der zur Rockmusik keinerlei Bezug hat, dem ergo die Kenntnis fehlt, dieses Festival in den richtigen Kontext zu stellen. Das Album „We Are Ever So Clean“ von The Blossom Toes befördert er zum besten Popsike-Album, „das je veröffentlicht wurde.“ (213) Sein angelesenes Wissen über Family resultiert in Käse. Und wenn er behauptet, seit „1967 gehörte es zu den Spielregeln, dass die Musiker umsonst spielten“ (241), so ist das einfach Stuss.
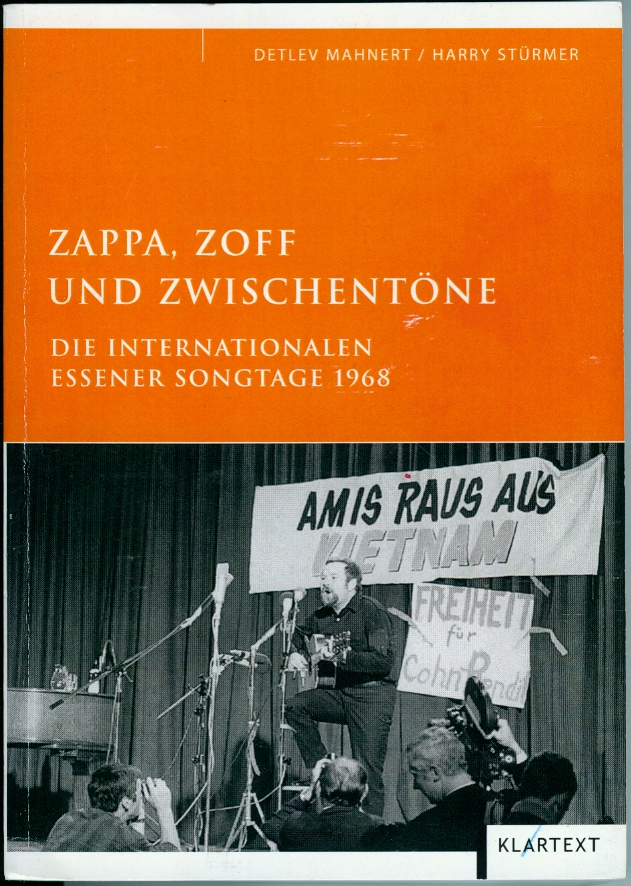 Detlev Mahnert ist kein Musikjournalist. Er verfügt nicht über die Terminologie, um Musik zu beschreiben. Die Musik von Amon Düül wird zur „Lärmshow“ (172), der Afro wird zur „Papua-Frisur“. Er erfindet den „Underground-Schreisänger“. Die Hammond von Brian Auger wird zur „Wurlitzer“. Und wie magnetisiert greift Mahnert immer wieder auf die falschen Quellen zurück, oder zitiert solch himmelschreienden Unsinn wie aus der Hessischen Post Homberg vom 7.9.68 (211). Man fragt sich, warum Mahnert permanent den hahnebüchenden Unsinn von Thilo Koch zitiert. Er schreckt nicht davor zurück, selbst den größten Blödsinn aus dem Kolpingblatt (!!) (295) anzuführen und zu unterstellen, das Handelsblatt hätte Wesentliches zur Musik zu verlautbaren (296). Den Megahammer aber leistet Mahnert, indem er Gisela op den Camp vom Bielefelder Westfalen-Blatt zitiert: unglaublicher Mist von „psychodelischen Träumen“, bei dem sich mir die Nackenhaare kräuseln: „Man war sich wohlwollend einig, kam, glotzte und konsumierte: Das ganze bunte Allerlei-Programm der ganzen Einerlei-Gesellschaft. (…) Die angelsächsisch sexisch im Untergrund wühlte und langhaarige Mähnen über faschistische Politik und Pillen-Moral schüttelte. Den Parka um die Schultern und Mutterns Care-Paket unterm Arm bezahlten Popper und Protestler brav ihren Eintritt, sammelten Posters und linke Zeitschriften, waren „in“ und klatschten Beifall.“ (296f) Das ist sprachlicher und inhaltlicher Müll.
Detlev Mahnert ist kein Musikjournalist. Er verfügt nicht über die Terminologie, um Musik zu beschreiben. Die Musik von Amon Düül wird zur „Lärmshow“ (172), der Afro wird zur „Papua-Frisur“. Er erfindet den „Underground-Schreisänger“. Die Hammond von Brian Auger wird zur „Wurlitzer“. Und wie magnetisiert greift Mahnert immer wieder auf die falschen Quellen zurück, oder zitiert solch himmelschreienden Unsinn wie aus der Hessischen Post Homberg vom 7.9.68 (211). Man fragt sich, warum Mahnert permanent den hahnebüchenden Unsinn von Thilo Koch zitiert. Er schreckt nicht davor zurück, selbst den größten Blödsinn aus dem Kolpingblatt (!!) (295) anzuführen und zu unterstellen, das Handelsblatt hätte Wesentliches zur Musik zu verlautbaren (296). Den Megahammer aber leistet Mahnert, indem er Gisela op den Camp vom Bielefelder Westfalen-Blatt zitiert: unglaublicher Mist von „psychodelischen Träumen“, bei dem sich mir die Nackenhaare kräuseln: „Man war sich wohlwollend einig, kam, glotzte und konsumierte: Das ganze bunte Allerlei-Programm der ganzen Einerlei-Gesellschaft. (…) Die angelsächsisch sexisch im Untergrund wühlte und langhaarige Mähnen über faschistische Politik und Pillen-Moral schüttelte. Den Parka um die Schultern und Mutterns Care-Paket unterm Arm bezahlten Popper und Protestler brav ihren Eintritt, sammelten Posters und linke Zeitschriften, waren „in“ und klatschten Beifall.“ (296f) Das ist sprachlicher und inhaltlicher Müll.
Weite Teile des Buches sind schlichtweg redundant, da der Autor bereits Gesagtes mehrfach wiederholt oder dutzendfach Zeitungsartikel zitiert, in denen schlichtweg Unsinn steht. Da fragt man sich schon, was das soll. Seine Zitierweise genügt keinerlei (vor)wissenschaftlichen Ansprüchen: das Jahr der Veröffentlichung ist ihm nicht bekannt, die Zitate sind oft nicht ausgewiesen oder die Relevanz für den Gegenstand zumindest zweifelhaft (189).
Die kleineren Sachfehler bzgl. der Auftritte von David Peel oder des instrumental set von The Mothers of Invention seien im verziehen, aber was die „schockierende Show der Mothers of Invention“ (190) war, hätte beschrieben werden müssen. Ich fand da nichts schockierend.
Als Musikzeitung kennt DM allein die Bravo, nicht OK, Musikparade, Song – oder die bereits 1968 existierende Sounds (ich habe auf den IEST ein Abo unterschrieben), in der man sich durchaus über neuere Musik informieren konnte.
Mahnert spricht irrsinnigerweise von Musik aus Studio B als Kultsendung (179). Am meisten hat ihn Rick Abao beeindruckt, der so geflissentlich „Ein Männlein steht im Walde“ intoniert hat. Hallo?
Er bemängelt, dass die Medien für alle IEST-Besucher das Wort „Hippie“ benutzen, tut aber selbst das gleiche und dann noch auf einen Musiker wie Frank Zappa bezogen (187)! Nervend und sprachlich arm ist es, wenn er Zappa permanent als „Obermutter“ bezeichnet. Wie war das? Deutsch und Französisch?
Wenn jemand etwas Positives zur IEST veröffentlicht hatte, so unterstellt Mahnert heute, dass sich besagter Journalist „sich den einen oder anderen Joint gegönnt und mit THC im Blut und Sonne im Herzen alles im bewusstseinsvernebelnden Licht von Hübingers Stroboskop gesehen (hat), in dem Konturen nicht immer zu erkennen waren.“ (293)
Ständig grützt dieser bornierte ex-Gymnasiallehrer Abfälliges über die Besucher der IEST. Die dort politisierenden findet er allemal nur minderbemittelt und fehlgeleitet. Solche versucht er auf ironische Art in Misskredit zu bringen (195). Wir müssen dann Diffamierendes lesen, wie „nach Genuss des ersten Biers noch mutiger geworden“ (195) oder „[der] (…) Gedanke an das Freibier lockte wohl zu sehr.“ (195) Er degradiert „das schmallippige Mädchen mit Nickelbrille, das nicht so aussah, als habe es von den Freuden des Lebens mehr als nur sporadisch genascht. Typ strenge Junglehrerin (Mathematik, Philosophie) [NB: Hey, der Mann war Mitglied der Schulleitung!], von der sexuellen Revolution nicht einmal gestreift.“ (156), um gleichzeitig gegen die „eher auf untere Körperhälften fokussierten Beziehung Obermaier – Langhans“ (173) zu polemisieren.
Wenn Mahnert die IEST zur Geburtsstunde des Krautrock erklärt, so ist das schlichtweg falsch. Im Frühjahr 1968 spielte die Guru Guru Groove Band das gleiche Set schon in Schwabing, und Tangerine Dream hatten sich gerade neu benannt, spielten aber noch die Musik der Ones. Auch Soul Caravan hatten sich noch nicht vom Soul gelöst. Es ist sowieso unmöglich, sich auf die Geburtsstunde von Krautrock, oder irgendeines anderen Genres, festzulegen. Musikalische Entwicklung ist immer eine fließende. Mahnert tut so, als sei die Provokation 1968 als Element der Musik neu. Rock ’n‘ Roll war immer Provokation, man denke an Elvis kreisende Hüften, das Auftreten der Rolling Stones, John Lennons Jesus-Vergleich.
Sein Sendungsbewusstsein stellt Detlev Mahnert auf seiner Webseite unter Beweis. Man erfreue sich daran, dass er es goutiert, wenn ein Schulleiter alle Toilettentüren für die Schüler aushängen lässt. Das ist ja mal Pädagogik, wie man sie sich wünscht. Wie erzkonservativ Mahnert ist, offenbart er auf S.173f: „der Künstler und seine Muse“. Und so ist auch seine Sprache: „Das Essener Publikum dankte es ihnen mit großem Applaus.“ (176)
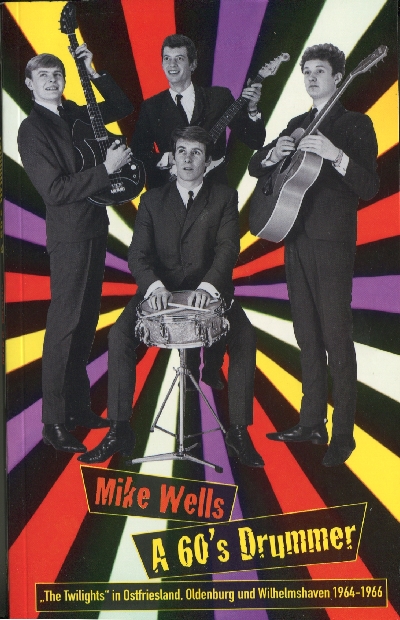 Mike Wells, A 60’s Drummer – „The Twilights“ in Ostfriesland, Oldenburg und Wilhelmshaven 1964-1966, Isensee Verlag, Oldenburg 2011, 978-3-89995-766-2 (€9,80).
Mike Wells, A 60’s Drummer – „The Twilights“ in Ostfriesland, Oldenburg und Wilhelmshaven 1964-1966, Isensee Verlag, Oldenburg 2011, 978-3-89995-766-2 (€9,80).
Mike Wells war Drummer einer englischen 60s Beatband aus der 3. Liga: The Twilights. Sie wurden für einen Monatsjob (de facto jedoch zwei Monatsjobs) nach Wilhelmshaven verschlagen, in Wolfgang Ullrichs Big Ben Club, nachdem Keith Moon Mike beim Transport des neu erworbenen Schlagzeugs von der Shaftesberry Avenue in die Marlborough Avenue geholfen hatte. Anschließend hatten die Burschen Engagements im Haus Waterkant in Norddeich, im Töff Töff, Oldenburg, im Café Dehos zu Mainz, in Kaiserslautern, Wiesbaden. Überall dort haben sie die weibliche Jugend (und nicht nur diese) flachgelegt, oft gesoffen, bis der bei Brenninkmeyer erworbene Kamelhaarmantel vollgekotzt war, und die Musik gemacht, welche die Gastwirte wünschten. Gelegentlich gab es Probleme mit dem Bandbus, mit Hotelgardinen oder fehlenden Waschgelegenheiten. Dann wieder wurde man von „Moder“ ganz hervorragend bekocht. Hatte man Geld in der Tasche, wurde dies flugs wieder unter das Volk gebracht.
Diese Geschichten hat Mike Wells nun aufgeschrieben. Es ist ein Buch entstanden, welches Jürgen Zöller von BAP lobt – dieser Zusammenhang erschließt sich mir nicht.
Die Vertextung bei A 60’s Drummer ist hölzern, aber das mag dem Übersetzer geschuldet sein. Allerdings: Intellektuell anspruchsvoll ist das Buch nicht. Bei meiner Arbeit an Shakin‘ All Over und Otto & die Beatlejungs habe ich viele Geschichten über das Leben als Musiker in den 60ern in Deutschland hören dürfen, und die meisten klangen wie diese, manche interessanter. So hat mich das Buch nicht wirklich aus den Socken gehauen, doch dem weniger involvierten Leser wird es wichtige soziokulturelle Aufschlüsse in Bezug auf die Mittsechziger geben, auch wenn Wells diese nicht explizit darlegt. Der intelligente Leser wird zwischen den Zeilen lesen.
Das Zentrum von Mike Wells Welt in den 60ern lag offensichtlich zwischen seinen Beinen, und so ist dieser Disziplin viel Raum im Buch gegeben. Appetitlich ist es nicht immer, aber wenn sich jemand über sein Geschlechtsteil definiert, dann kommen eben ferkelige Geschichten dabei raus. Mich interessieren die Flecken auf Mike Wells Bettlaken nicht. Punkt. Sein Bramarbasieren erinnert mich an meinen Großvater, wenn dieser aus dem ersten Weltkrieg vor Verdun palaverte. Erstaunlich ist, dass sich der Isensee Verlag auf dieses Niveau eingelassen hat.
Ich war bei der Lesung aus dem Buch im Kling Klang, Wilhelmshaven, und ziemlich erstaunt, dass gerade bei den anrüchigen Passagen zu Lasten der involvierten Mädels die anwesenden Damen am lautesten kicherten. Wahrscheinlich bin ich in dieser Welt nicht mehr richtig einjustiert.
Um es auf den Punkt zu bringen: beim Isensee Verlag in Oldenburg kann man ein Buch erwerben, dass viele Menschen amüsieren wird, weil es die 60er Jahre (the 60s) aus der Sicht eines Musikers von Sohle 3 beschreibt. Manche werden dieses Buch eher weniger interessant finden.
 Wolfgang Matthiessen, TWIST & SHOUT – Flensburger Beatszene der Jahre 1962 bis 1972, Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, 3. Auflage, 2011, 978-3-925856-64-8, inkl. CD (€25,-)
Wolfgang Matthiessen, TWIST & SHOUT – Flensburger Beatszene der Jahre 1962 bis 1972, Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, 3. Auflage, 2011, 978-3-925856-64-8, inkl. CD (€25,-)
Junge, Junge. 265 Seiten Fleißarbeit! Ein schier unendlicher Steinbruch für alles das, was die Flensburger Musikszene der 60er ausmacht (aber aufgemerkt, der Beat ging dort noch bis 1972, eine lokale Besonderheit sicherlich).
Wolfgang Matthiessen hat keinen Stein vergessen umzudrehen, um uns das komplette Beat-musikalische Bild einer Stadt im hohen Norden zu zeichnen. Es wird klar: trotz der relativen Nähe zu Hamburg setzt der Rock ’n‘ Roll nur spät seine Duftmarken droben in Schleswig-Holstein. Wo in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordbayern bereits seit Jahren der Bär steppt, Dank des Einflusses der amerikanischen Besatzungssoldaten, müssen die 6 Desperados als die Speerspitze der Flensburger Musikanten Ende 1962 noch den Kontrabass durch die Gegend schleppen. Da war in Hanau oder in Offenbach bereits alles weiß mit Fender-Stratocaster-Gitarren und Fender-Verstärkern.
Ja, mühsam ernährt sich das Flensburger Eichhörnchen, doch irgendwann ist der Bunker gefüllt, und man kann auch dort den Beat brettern, wo vorher noch das Akkordeon dominierte. Immerhin gibt es ganz fix – und zwar seit dem 1.8.64 – für kurze Zeit den Star-Club Flensburg, und so kommen die Holsteiner auch in den Genuss der üblichen Star-Club-Bands. King Size Taylor, Lee Curtiss, The Rattles, The Tremors, Ian & The Zodiacs, aber auch Die Tornados (später The Rollicks) aus Berlin geigen der Jugend einen vor, so dass der Lokalpresse Hören und Sehen vergeht.
Matthiessen legt sein Augenmerk auf die stadteigenen Bands, und er tut dies mit sehr viel Akribie und Forschergeist. Wer immer eine Saite bog, wer immer eine Taste drückte oder ein Fell beklopfte, um zu erzeugen, was gemeinhin als Beatmusik bezeichnet wird, kommt hier zu Ehren. Die Bandstorys sind so ausführlich, wie es eben geht, aber darin liegt auch immer eine Gefahr. So mangelt es Matthiessens Schreibstil ein wenig an Beat und Rock ’n‘ Roll. Herr Matthiessen ist schreibtechnisch eher zurückhaltend, nüchtern und unkreativ. Kurzum: seine Schreibe ist ein wenig bieder.
Was mir in diesem Buch fehlt, ist ein soziokultureller Ausflug in die Welt der regionalen, der Flensburger Beatszene. Die Übernahmen von Anzeigen und Ankündigungen aus dem Flensburger Tageblatt für die einzelnen Jahre sind diesbezüglich etwas dünnbrüstig, vor allem da man weiß, dass die lokale Presse nicht vorurteilsfrei mit dem Beatphänomen umgegangen ist. So muss man bei den Bandgeschichten mühsam zwischen den Zeilen lesen, um etwas mehr über die soziokulturellen Besonderheiten der Stadt an der dänischen Grenze zu erfahren.
Ich kann dieses Buch all jenen empfehlen, die die Geschichte der Beatmusik in der BRD lückenlos dokumentiert vorliegen haben wollen. Falls jemand jedoch an Rock-’n‘-Roll-writing interessiert ist, sollte er sich anderweitig umschauen.
Ja, eine CD ist auch gratis dabei. Da gibt es zumindest drei Flensburger 60s Bands mit Tonbeispielen in guter Qualität.
 Keep It Together!: Cosmic Boogie with the Deviants and the Pink Fairies von RICH DEAKIN ist ein wunderbares Buch, welches den britischen (sprich: Londoner) Underground beleuchtet und erhellt. Alle relevanten Zeitzeugen kommen zu Wort, und nebenbei gibt es die ausführlichen, aber nicht weitschweifigen Geschichten von zwei völlig schrägen Bands – The Deviants und the Pink Fairies. Natürlich werden auch Blutsbrüder wie the Pretty Things, The Edgar Broughton Band, Man, the MC5 etc. gewürdigt. Und an Hawkwind – die oft genug mit den Fairies als Pinkwind aufgetreten sind – führt allemal kein Weg vorbei. It, Oz und Frendz als Undergroundzeitungen werden in ihrer Relevanz aufgezeigt. Begebenenheiten um Events wie The 14 Hour Technicolour Dream, Glastonbury Fayre, Isle of Wight Festival machen die Lektüre spannend.
Keep It Together!: Cosmic Boogie with the Deviants and the Pink Fairies von RICH DEAKIN ist ein wunderbares Buch, welches den britischen (sprich: Londoner) Underground beleuchtet und erhellt. Alle relevanten Zeitzeugen kommen zu Wort, und nebenbei gibt es die ausführlichen, aber nicht weitschweifigen Geschichten von zwei völlig schrägen Bands – The Deviants und the Pink Fairies. Natürlich werden auch Blutsbrüder wie the Pretty Things, The Edgar Broughton Band, Man, the MC5 etc. gewürdigt. Und an Hawkwind – die oft genug mit den Fairies als Pinkwind aufgetreten sind – führt allemal kein Weg vorbei. It, Oz und Frendz als Undergroundzeitungen werden in ihrer Relevanz aufgezeigt. Begebenenheiten um Events wie The 14 Hour Technicolour Dream, Glastonbury Fayre, Isle of Wight Festival machen die Lektüre spannend.
Das Buch setzt sich durchaus kritisch und differenziert mit allen Aspekten des Londoner Kommunelebens, der politischen Attitüde, der unterschiedlichen Charaktere in den entsprechenden Bands und den Eitelkeiten und sozialen Kompetenzen der Musiker auseinander.
Die Geschichte der Pink Fairies ab der re-union in den 80er Jahren ist dann weitgehend eine Ansammlung von Fakten und relativ anstrengend zu lesen. Davor bringen viele Anekdoten zum Teil köstliche Unterhaltung, doch stilistisch könnte das Buch etwas runder sein. Eine CD mit z.T. bislang unveröffentlichtem Material liegt dafür bei.
Es ist müßig zu erwähnen – ich war ein großer Pink-Fairies-Fan! Und weil ich mich in hartbeat! kritisch zu ihm geäußert hatte, hat mich Larry Wallis 1988 in Bochum aus dem Backstageraum gejagt. Das letzte, was er mir nachrief, war: „I was in this band [Motörhead] for f***ing fourteen months!!!“
Ich habe mir zu Weihnachten „Life“ von Keith Richards gewünscht – und auch bekommen. Es war nicht die tolle Lektüre, die ich erwartet hatte. Für amazon.com habe ich eine Rezension geschrieben. Hier ist sie:
One boring old fart
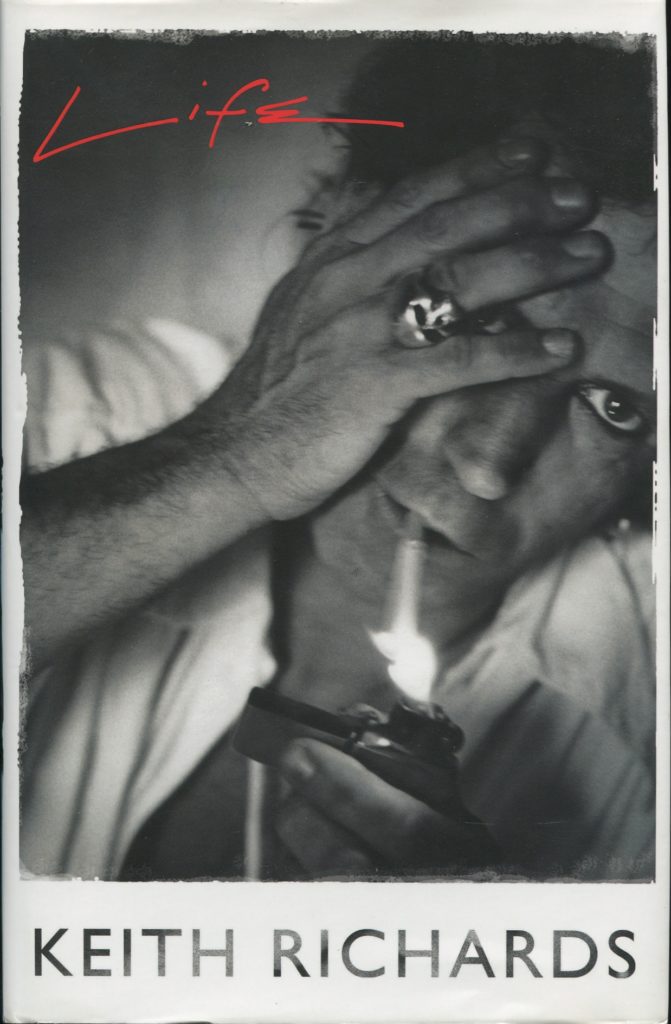 A lot of people have been very enthusiastic about this book. I am not. Surely Keith Richards has got a few stories to tell, but so would everybody after being in Rock biz for nigh 50 years. It’s the way he tells these stories – absolutely anticlimactic!
A lot of people have been very enthusiastic about this book. I am not. Surely Keith Richards has got a few stories to tell, but so would everybody after being in Rock biz for nigh 50 years. It’s the way he tells these stories – absolutely anticlimactic!
This book – just does not rock!
He obviously is not a man of letters, something he tries to make up for by using expletives as often as possible. Let’s face it: Unlike Deke Leonard or Sean Tyla, whom he probably has never heard of, Keith Richards has not got it in him to make the words roll.
All that repetitive shit about the validity of the Blues and how he found out about the 5-string open tuning and its advantages!! A couple of lines would have been okay, but pages?
All that repetitive bullshit about him and Mick being like brothers!! I mean, Keith hasn’t been inside Jagger’s backstage room for more than 20 years and they’ve been flinging more abuse at each other via the tabloids than there are stars in the sky. Brothers? You do not have to read between the lines, you can actually smell how Mister Richards is begrudging Mick the knighthood. The way Keef expected it to go was that Mick would decline and say „Never ever – if Keith doesn’t get one at the same time“.
Keith, you are a bore!
Believe it or not, but Keith Richards‘ daughter’s fiancé must ask permission to marry her from his to-be-father-in-law!! Hey, where are we? Britain in the 50s? This guy is as conservative as my wife’s auntie who accused us of living in sin as we weren’t married and yet living together in 1974. At the same time he’s quite out of his mind. Who – if not a loony – would risk spoiling his daughter’s wedding just because his son’s mate is wearing a couple of spring onions behind his ears – and later be bragging about it in a book?!
This man has been in a state of intoxication for more than 40 years now. Starting off with psychedelic drugs he soon got involved in smack and after coming off that it was cocaine, more weed and Jack Daniels (or was it Jim Bean?). A good deal of this book is dedicated to his exploits as a drug abuser. That’s what I already loathed about David Crosby’s book „Long Time Gone“. It’s like those war veterans like my granddad bragging about WW1 and when he was down in the trenches of Verdun looking the enemy in the cold eye. And staring the enemy down, of course, or escaping the mortal bullet quite close – which hit his helmet and ricocheted back to kill one of the Tommies.
After all those years Keith Richards still can’t forgive the Sex Pistols for calling the Rolling Stones boring old farts and in return he’s accusing them of not being able to master their instruments properly. As if Rock ’n‘ Roll had got anything to do with that! Keith, how deep can the wound be?
And all those quotes from other people flattering him! How low must his self-esteem be? What’s worst is the name dropping – he even got a letter from Tony ****ing Blair after he’d banged his head. I’m impressed.
Many things have not even been touched in „Life“. Sadly there’s no word about „December’s Children“, „Between The Buttons“, „We Love You“ or „2000 Light Years“ – but at the same time Keith takes his time and wants to sell us the single „Street Fighting Man“ as a genuine political statement, which was released at a time when the Stones were recognizing they were not as wealthy as they ought to be – despite owning mansions and Bentleys – and thus hiring different managing personnel. I can’t remember any single person who believed „Street Fighting Man“ to be a sincere political statement back then, even those who were in favour of the Stones.
To garnish my consumption of „Life“ I watched the Rolling Stones live in Japan 1990, and I was not impressed. Wood pulling off a couple of guitar hero stances in yellow sneakers (why not pink?), Richards doing his best to add a bit of Arena Rock atmosphere, and that ponce Jagger prancing about with the phrasing all wrong and sounding so mannered that it hurt. I knew we could write them off after disrespectfully throwing buckets of water on their audience – which is the hand that feeds them, right? – during their early 70s tour.
Mind: I used to be a devoted (and I mean „devoted“) Rolling Stones fanatic in my teens.
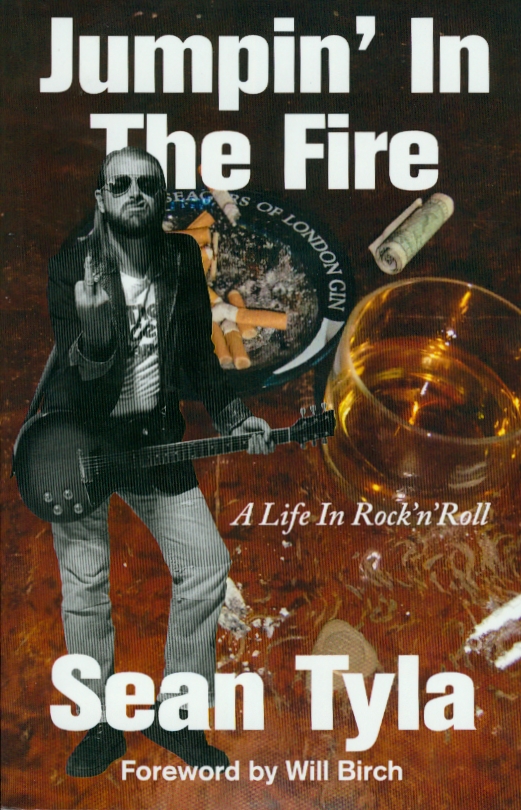 Schreibt ein Rock ’n‘ Roller ein Buch, so ist ja nicht immer gewährleistet, dass dieses auch genauso rockt, wie seine Musik. Nun hat Sean Tyla seine Erinnerungen an die Zeit mit Ducks Deluxe und deren Nachfolger Tyla Gang niedergeschrieben. Ich bin ein großer Ducks Deluxe-Fan, und ich habe gleich meine komplette Ducks-Deluxe-Sammlung herausgeholt, und während ich dies schreibe, läuft ein Liveband aus Boddy’s Music Inn von 1974. Einfach grandioser Pubrock.
Schreibt ein Rock ’n‘ Roller ein Buch, so ist ja nicht immer gewährleistet, dass dieses auch genauso rockt, wie seine Musik. Nun hat Sean Tyla seine Erinnerungen an die Zeit mit Ducks Deluxe und deren Nachfolger Tyla Gang niedergeschrieben. Ich bin ein großer Ducks Deluxe-Fan, und ich habe gleich meine komplette Ducks-Deluxe-Sammlung herausgeholt, und während ich dies schreibe, läuft ein Liveband aus Boddy’s Music Inn von 1974. Einfach grandioser Pubrock.
Ich hatte so meine Bedenken, ob Tylas Schreibe der Musik pari kommen könnte, aber wie Deke Leonards „Rhinos, Winos & Lunatics“ ist „Jumpin‘ In The Fire“ ein Buch, dass von den ersten Zeilen an fesselt und nicht nur durch die Anekdoten und geschilderten Ereignisse überzeugt, sondern auch durch eine punktgenaue Vertextung. Hier steht kein überflüssiges Wort – im Gegensatz zu Keith Richards „Life“ – und mitunter ist es traurig mitzuerleben, wie Tyla und seine Freunde als Spielball in einem Flipperspiel von Managern und A&R-men herhalten müssen. Für eine Band aus der 2.Liga der 70er war eine Hose zum Wechseln Luxus, und gelegentlich mussten schon mal die Gitarren verkauft werden, um die Familie zu  ernähren. Aber auch Erhellendes über Weggefährten wie Nick „Basher“ Lowe und Dave „Dai“ Edmunds hat Tyla auf Lager. Und wenn das Buch dann in der unvollendeten Geschichte endet, ist man schon überrascht. Nun, das Ende hätten wir auch gerne erfahren! Ist aber nicht! That’s Rock ’n‘ Roll.
ernähren. Aber auch Erhellendes über Weggefährten wie Nick „Basher“ Lowe und Dave „Dai“ Edmunds hat Tyla auf Lager. Und wenn das Buch dann in der unvollendeten Geschichte endet, ist man schon überrascht. Nun, das Ende hätten wir auch gerne erfahren! Ist aber nicht! That’s Rock ’n‘ Roll.
Erschienen bei Soundcheckbooks, erhältlich auch über amazon – und ein Muss.
Und als Garnierung ein paar relevante Plattencover. Die Nick-Lowe-Single-A-Side wurde von Wilko Johnson geschrieben, aber auf der Rückseite verbirgt sich der best-ever-Nick-Lowe-track. A real killer Punk-tune. „The Truth Drug„
Und, das Sahnehäubchen, SEAN TYLA & HIS GANG Amsterdam Dog – produced by the Ducks – auf Dynamo (NL)
Von Beatles bis Bowie – The London 60s ist der Katalog zur gleichnamigen Ausstellung mit Fotoarbeiten zur populären Musik von 1960 (als es die Beatles noch nicht gab) bis 1969. Die Ausstellung wurde in der National Portrait Gallery, London, gezeigt, danach in der Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne, und anschließend in der Norwich Castle Museum and Art Gallery. Es werden schöne Exponate der bedeutendsten und besten Rockfotografen, die die 60er Jahre hervorgebracht haben, gezeigt. Die Fotos sind von höchster künstlerischer und abbildungstechnischer Qualität; die Reproduktionen sind state-of-the-art. Soweit erste Sahne. Allerdings… „Von Beatles bis Bowie“ und dann The Beatles und The Who auf dem Cover!?
Eine bittere Pille sind jedoch die begleitenden Texte, die sich auf einem Niveau bewegen, welches für einen Ausstellungskatalog nicht tolerierbar ist. Jon Savage hat das einleitende Essay geschrieben. Ich besitze seine Biographien zu The Kinks und The Sex Pistols. Beide sind mir nicht als besonders herausragend in Erinnerung geblieben, allerdings sind sie in meinem Gedächtnis auch nicht negativ besetzt. Das Bild, welches Savage hier von den 60s zeichnet, ist jedoch von Vordergründigkeiten, Banalitäten, Vorurteilen, Halbwahrheiten und sprachlichem Gewürge, wie „wichtigster Einfluss im Underground war der britische Blues-Boom“ (S.24), geprägt. Ich kenne den Originaltext nicht, deshalb kann ich nicht beurteilen, ob die sprachlichen Defizite allein dem Übersetzer anzulasten sind. Walter Ahlers hat kein Problem damit, gleiche Satzmuster – zum Beispiel Hauptsatz mit eingeschobenem Relativsatz – gleich dreimal hintereinander zu verwenden, etwas was in jedem Schüleraufsatz als Ausdrucksschwäche markiert würde. Ein Lektorat gab es offensichtlich nicht: dies zeigt sich am Beispiel der Kopplungen. Gelegentlich wird konsequent durchgekoppelt, dann zur Hälfte, dann wieder gar nicht. Ein Lektor hätte dies vereinheitlicht.
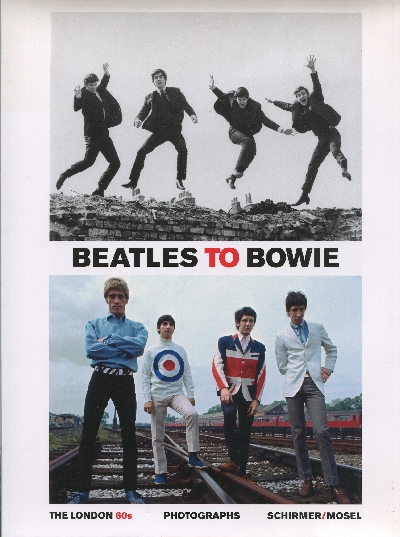 Aber der Unsinn, den Savage hier schreibt, hätte einer gründlichen Redaktion bedurft – nicht allein, weil selbst Songtitel falsch geschrieben werden („Heartful of Soul“ statt „Heart Full Of Soul“ (S.19)). Ein Redakteur hätte bemerkt, dass die Aussage „Das Cover zeigt The Dave Clark Five im typischen Outfit (NB: Was für ein Unwort!) – weißes Polohemd (…)“ (S.101) falsch ist. Sie tragen Rollkragenpullover!
Aber der Unsinn, den Savage hier schreibt, hätte einer gründlichen Redaktion bedurft – nicht allein, weil selbst Songtitel falsch geschrieben werden („Heartful of Soul“ statt „Heart Full Of Soul“ (S.19)). Ein Redakteur hätte bemerkt, dass die Aussage „Das Cover zeigt The Dave Clark Five im typischen Outfit (NB: Was für ein Unwort!) – weißes Polohemd (…)“ (S.101) falsch ist. Sie tragen Rollkragenpullover!
Auch der Inhalt ist stellenweise grenzwertig, was einem informierten Redakteur hätte auffallen müssen: „Die Beatles waren, wie ihre Fans der ersten Stunde, keine Teenager mehr; sie hatten andere Interessen (NB: als was?) und familiäre Verpflichtungen. 1969 heiratete Paul McCartney Linda Eastman, John Lennon heiratete Yoko Ono.“ (S.24). Nun hatte es für die Beatles bereits weit vor diesem Jahr Unterhaltsverpflichtungen gegeben, aber immerhin entdeckt Savage David Bowie für 1969, „das Jackett mit einem Anflug von Retro“ und „einen Star, der sein Image im Griff hat.“ (S.25). Dann behauptet er, dass Doncha Bother Me von den Rolling Stones 1966 acht Wochen No.1 in den Charts war (S.25), ein Song, der nur auf einer LP veröffentlicht wurde! 1969 hat Led Zeppelin angeblich „3 Top-Ten-Alben“ (S.24). Immerhin findet er in London „senkrechte Straßenlaternen“ (S.19), wahrscheinlich waren ihm sonst nur waagerechte bekannt. Dummerweise hält er ein Aufputschmittel („Purple Hearts“) für eine „Jugendkultur“ (S.19).
„1965 wurde zunächst Cannabis, später auch LSD von der Pop Elite übernommen.“ (S.19). Na, wenn das mal kein sprachliches wie auch inhaltliches Meisterstück ist!! Und die Ironie von Dedicated Follower Of Fashion als sardonisch zu bezeichnen, schießt über das Ziel hinaus. Schön finde ich die Charakterisierung von „Jimi Hendrix, einem zugezogenen Schwarzamerikaner in Carnaby Street-Klamotten.“ Wunderbar. Gelegentlich bringt Savage mal ein paar Bands durcheinander, wie Cream, Traffic und Jeff Beck (S.22).
Nun werden populäre Musiker wie Traffic und Jeff Beck zu „Underground-Größen“ erklärt (S.21), und dann sträuben sich doch die Nackenhaare. Oder wenn dem Fischaugen-Objektiv ein „Desorientierungseffekt“ (S.22) zugeschrieben wird. Witzig finde ich solche Aussagen wie „Steve Winwood (…) widersetzte sich der Konvention, in dem er zum Leben und Arbeiten aufs Land zog.“ (S.22). Es war mir unbekannt, dass er Bauer oder ähnliches wurde. Ich habe ihn weiterhin auf den Bühnen der großen Städte seine Musik machen sehen.
Hanebüchend wird es, wenn es heißt, dass die „durch den Rückzug der Beatles und Bob Dylans entstandene Lücke“ 1967 u.a. von The Foundations geschlossen wurde (S.22): Einen größeren Stuss habe ich selten gelesen.
Ein sprachlicher Klassiker ist der folgende Satz von S.23: „1968 brachten Underground-Musiker die kreativsten Bilder.“ Und ich dachte, die Bilder kamen von den Fotografen! Oder zumindest von Malern.
Walter Ahlers übersetzt auch die Texte zum eigentlich Bildteil „Die Sixties – Jahr für Jahr“. Terence Pepper ordnet die Bilder nicht thematisch, sondern nach Jahren. Dabei verfasst er längere Texte zur Erklärung dieser Bilder. Mitten im Absatz wechselt er die Themen (S.52, S.80 usw.). Manches bleibt völlig inkohärent. Es kommen sprachliche Trümmergrundstücke zum Vorschein, die man nicht für möglich hält. Zu Johnny Kidd findet er eine „minutiös komponierte Seeräuberkulisse“ (S.28). Dann heißt es sinnschwanger, doch unverständlich: „Er produzierte choreographierte Studien von Großbritanniens erfolgreichster Gruppe des Jahres – The Shadows.“ (S.28). Schlichtweg sprachlichen Blödsinn finden wir dann auf S.80 – „Am 30. September formierte er die Köpfe der Rolling Stones zu einer quadratischen Komposition, aus der ein Albumcover wurde“ – oder auf S.38: „1960 verteilten sich Pop-Photos auf diverse Formate, von denen das Albumcover wohl das wichtigste war, zu denen aber auch die für das Platten kaufende Teenagerpublikum attraktiven Medien gehörten.“ Abgesehen davon, dass kurz vorher noch konstatiert wurde, dass in der Frühzeit des Britpop das Album kaum eine Rolle spielte, ist das sprachlicher Kappes.
Pepper wartet mit grandiosen Erkenntnissen auf: er spricht sogar von einem „Erfinder der Carnaby Street“ (S.102). Mich würde nun noch der Name interessieren!
Ein paar Beispiele vom Niveau der Texte möchte ich noch aufführen: „Am 14. Januar schloss sich ein 18-tägiges Gastspiel in Paris an, und in dieser Zeit wurden sie von Jean-Marie Périer, dem führenden Photographen von Salut les copains beim Anzünden ihrer Zigaretten abgelichtet.“ (S.80) Da werden wohl eine Menge Streichhölzer bei draufgegangen sein. Oder: „Auf Cyrus Andrews‘ Portrait, das gleichzeitig mit David Bowies Single ‚Can’t Help Thinking About Me‘ erschien, trägt der Sänger eine Op Art-Krawatte.“
Ich mag gar nicht alles aufzählen, was ich beim kursorischen Lesen an inhaltlichen und sprachlichen Mängeln entdeckt habe. Eine intensive Lektüre habe ich nach kurzer Zeit eingestellt, weil es einen ärgert, mit einer solchen Masse von Unzulänglichkeiten konfrontiert zu werden, die aber nur hier und da auf Setzfehler zurückzuführen sind („Gerry and The Pacemakers waren in dem Ferry Cross the Mersey von Tony Clark zu sehen“ (S.122)) – oder mangelhafte Recherche, wenn bei 9 abgebildeten Musikern sechzehn Namen die Bildunterschrift zieren!
Bezüglich Billy Fury heißt es: „Er wurde in zwei seiner berühmtesten Verkleidungen photographiert, in einem T-Shirt als Hommage an James Dean von Ida Kar, der ersten Photographin, der eine größere Ausstellung in einer Londoner Kunstgalerie gewidmet war (…), und im Goldlamé-Jackett à la Elvis von David Wedgbury, Chefphotograph der Decca Records während des ganzen Jahrzehnts.“ (S.40). Dieser Satz mag exemplarisch dafür stehen, dass das Buch seinen sich selbst gesetzten Auftrag nicht erfüllt. Es will die Geschichte der Popmusik anhand der Fotos erklären, demaskiert diese aber als Verkleidungen, als historisch nicht relevanten Fake.
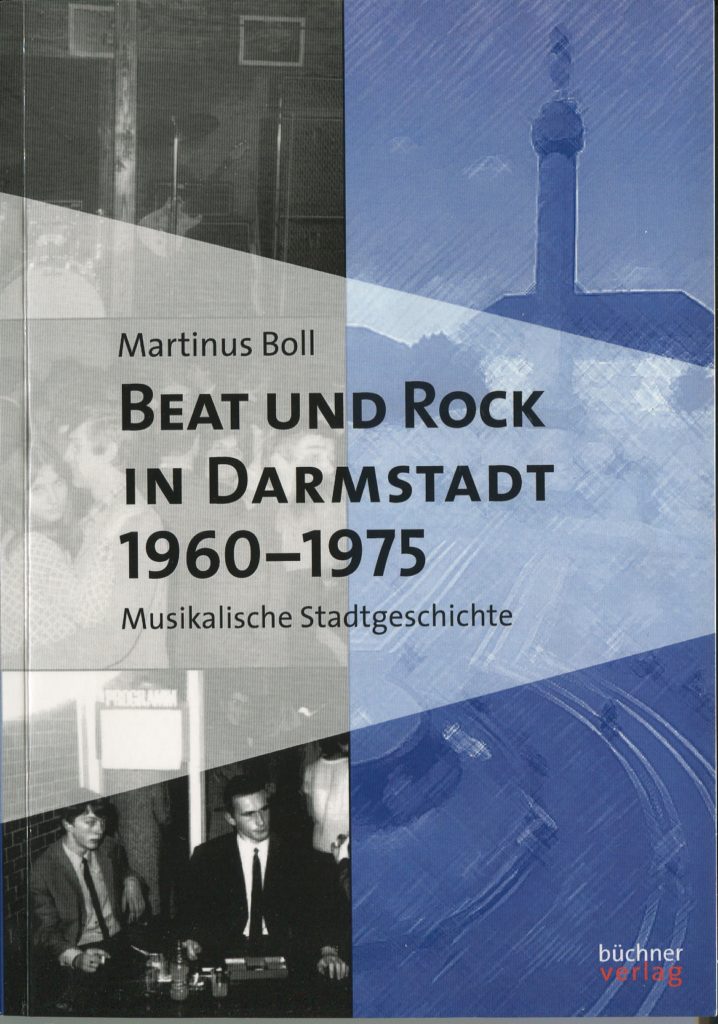 Martinus Boll (ich verwette meinen besten Borsalino, dass dies ein Pfarrerssohn ist! (Sorry, hier lag ich falsch. Irgendjemand vom Martinus-Boll-Fan-Club schrieb mir, er sei Lehrerssohn) hat uns ein Buch hinterlassen: „Beat und Rock in Darmstadt 1960-1975″ (Büchner Verlag, ISBN 978-3-941310-02-5, 2008, € 12,90). Herr Boll ist Kirchenorganist, und als solcher mag er die eine oder andere richtige Taste drücken, doch als Autor ist er schlichtweg eine Niete und hätte besser die Finger von den Keyboards gelassen. Boll fehlt jeder Rock ’n‘ Roll – seine Sprache ist hölzern, der Text uneingeschränkt langweilig, seine Erkenntnisse banal und oft falsch. Was Boll an Richtigem zu berichten hat, ist hundertmal gesagt geworden. Ich habe schon viele Bücher gelesen, die von ambitionierten, aber ungeübten Schreibern verfasst wurden, aber das Buch von Boll hat eine ganz besondere Qualität. Hier ein Beleg: „Die Auftritte (nicht, dass er selbst dort aufgetreten wäre… Anm. d. Verf.) in den US-Clubs hatten für mich immer die Aura des Mysteriösen, ja Exotischen. Durch meine zahlreichen Gespräche mit den Bandmusikern gelang es mir doch, mir einen besseren Überblick über die Hintergründe zum Thema US-Clubs zu verschaffen. Und diese möchte ich dem Leser dieses Buches nicht vorenthalten.“ (S.9) Nun überrascht Boll uns mit folgenden Worten: „Der amerikanische Club (in Musikerkreisen schlicht „Ami-Club“ genannt) war, wie ich später zeigen werde, eine völlig in sich abgeschlossene Welt, die neben der deutschen Schulball-Welt in den amerikanischen Standorten existierte.“ (ebd.) Das ist nicht nur inhaltlicher, sondern auch sprachlicher Müll. Ein Großteil des Fotomaterials sind streifige, unscharfe und in Unehren ergraute Fotokopien!! Ich bin überrascht, dass ein Verlag so wenig verlegerische Intuition hat, um ein solches Buch zu verhindern. Wenn es einen Preis gäbe für das schlechteste Musikbuch in Deutschland, wäre „Beat und Rock in Darmstadt 1960-1975″ der aussichtsreichste Wettbewerber.
Martinus Boll (ich verwette meinen besten Borsalino, dass dies ein Pfarrerssohn ist! (Sorry, hier lag ich falsch. Irgendjemand vom Martinus-Boll-Fan-Club schrieb mir, er sei Lehrerssohn) hat uns ein Buch hinterlassen: „Beat und Rock in Darmstadt 1960-1975″ (Büchner Verlag, ISBN 978-3-941310-02-5, 2008, € 12,90). Herr Boll ist Kirchenorganist, und als solcher mag er die eine oder andere richtige Taste drücken, doch als Autor ist er schlichtweg eine Niete und hätte besser die Finger von den Keyboards gelassen. Boll fehlt jeder Rock ’n‘ Roll – seine Sprache ist hölzern, der Text uneingeschränkt langweilig, seine Erkenntnisse banal und oft falsch. Was Boll an Richtigem zu berichten hat, ist hundertmal gesagt geworden. Ich habe schon viele Bücher gelesen, die von ambitionierten, aber ungeübten Schreibern verfasst wurden, aber das Buch von Boll hat eine ganz besondere Qualität. Hier ein Beleg: „Die Auftritte (nicht, dass er selbst dort aufgetreten wäre… Anm. d. Verf.) in den US-Clubs hatten für mich immer die Aura des Mysteriösen, ja Exotischen. Durch meine zahlreichen Gespräche mit den Bandmusikern gelang es mir doch, mir einen besseren Überblick über die Hintergründe zum Thema US-Clubs zu verschaffen. Und diese möchte ich dem Leser dieses Buches nicht vorenthalten.“ (S.9) Nun überrascht Boll uns mit folgenden Worten: „Der amerikanische Club (in Musikerkreisen schlicht „Ami-Club“ genannt) war, wie ich später zeigen werde, eine völlig in sich abgeschlossene Welt, die neben der deutschen Schulball-Welt in den amerikanischen Standorten existierte.“ (ebd.) Das ist nicht nur inhaltlicher, sondern auch sprachlicher Müll. Ein Großteil des Fotomaterials sind streifige, unscharfe und in Unehren ergraute Fotokopien!! Ich bin überrascht, dass ein Verlag so wenig verlegerische Intuition hat, um ein solches Buch zu verhindern. Wenn es einen Preis gäbe für das schlechteste Musikbuch in Deutschland, wäre „Beat und Rock in Darmstadt 1960-1975″ der aussichtsreichste Wettbewerber.
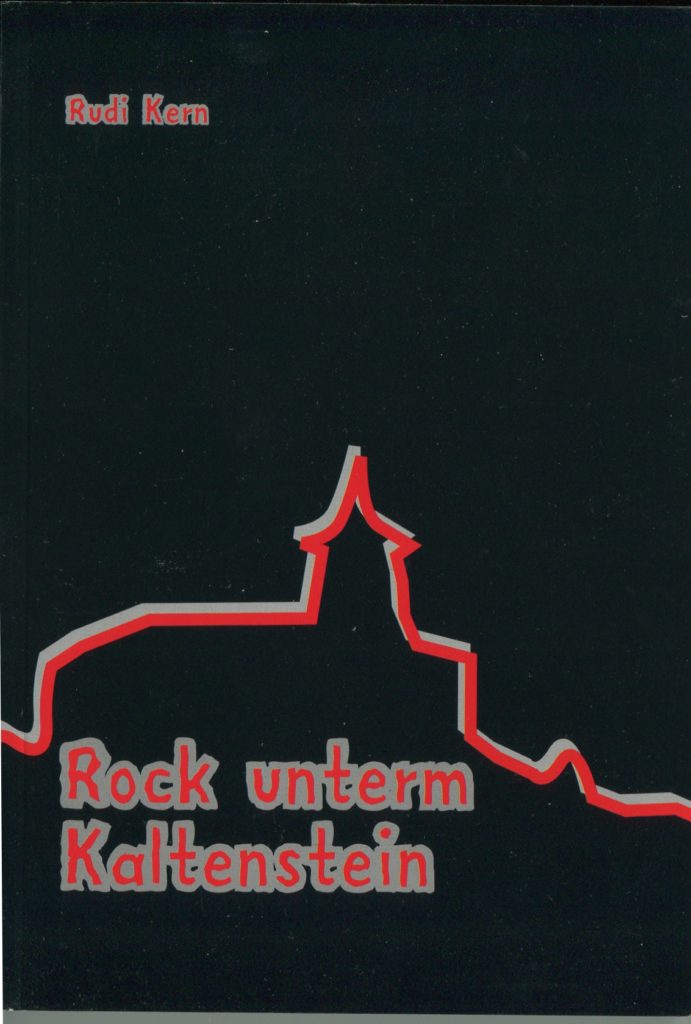 Rudi Kern, der so aussieht wie er heißt, hat ein nettes kleines Büchlein zu „Rock unterm Kaltenstein“ (IPa-Verlag, 2005) veröffentlicht. Rockmusik in Vaihingen hat er sich vor die Brust genommen, und ich muss gestehen, ich wusste nicht einmal, wo ich den Ort zu lokalisieren hatte. Dank Google maps bin ich nun schlauer, und ich weiß auch, dass THE LIGHTNINGS die großen BEATbringer in just jenem Kleinstädtchen waren, und dass Little Lord, der einsvierzig-kleingeratene Fritz Gröger, eine zeitlang deren Leadsänger war. Alle weiteren Bands in „Rock unterm Kaltenstein“ datieren aus späteren Jahren. Aber da gab es noch eine Tanzkapelle, The Players, und die hat mit „Bleib doch hier“ eine Single auf Elite Special hinterlassen. Das Buch hat keine ISBN-Nummer, aber der IPa-Verlag, 71665 Vaihingen/Enz-Roßwag, sollte aufzuspüren sein. Ich habe es ja auch geschafft. 🙂
Rudi Kern, der so aussieht wie er heißt, hat ein nettes kleines Büchlein zu „Rock unterm Kaltenstein“ (IPa-Verlag, 2005) veröffentlicht. Rockmusik in Vaihingen hat er sich vor die Brust genommen, und ich muss gestehen, ich wusste nicht einmal, wo ich den Ort zu lokalisieren hatte. Dank Google maps bin ich nun schlauer, und ich weiß auch, dass THE LIGHTNINGS die großen BEATbringer in just jenem Kleinstädtchen waren, und dass Little Lord, der einsvierzig-kleingeratene Fritz Gröger, eine zeitlang deren Leadsänger war. Alle weiteren Bands in „Rock unterm Kaltenstein“ datieren aus späteren Jahren. Aber da gab es noch eine Tanzkapelle, The Players, und die hat mit „Bleib doch hier“ eine Single auf Elite Special hinterlassen. Das Buch hat keine ISBN-Nummer, aber der IPa-Verlag, 71665 Vaihingen/Enz-Roßwag, sollte aufzuspüren sein. Ich habe es ja auch geschafft. 🙂
 Mein Lieblingkarikaturist ARI PLIKAT hat ein neues Buch veröffentlicht, („Das ist mein Hip Hop!“, Lappan) und für € 9,95 ist es einfach geschenkt. Dutzende Cartoons mit Biss, schrägen Typen und Sex Appeal (nebst Rock ’n‘ Roll!). Ari hat nicht nur seinen absolut eigenwilligen Stil, der unkopiert ist, er hat auch die skurrilsten Einfälle und einen Humor, der in seinem Sarkasmus und dem Rütteln an Taboos eher englisch als deutsch ist. Vielleicht ist das der Grund, warum er noch nicht der Superstar auf der Cartoonszene ist. Die Deutschen sind möglicherweise noch nicht reif für ihn. So wird es ihm gehen, wie den Monks: erst im hohen Alter wird ihm der Stellenwert zukommen, der ihm wirklich gebührt.
Mein Lieblingkarikaturist ARI PLIKAT hat ein neues Buch veröffentlicht, („Das ist mein Hip Hop!“, Lappan) und für € 9,95 ist es einfach geschenkt. Dutzende Cartoons mit Biss, schrägen Typen und Sex Appeal (nebst Rock ’n‘ Roll!). Ari hat nicht nur seinen absolut eigenwilligen Stil, der unkopiert ist, er hat auch die skurrilsten Einfälle und einen Humor, der in seinem Sarkasmus und dem Rütteln an Taboos eher englisch als deutsch ist. Vielleicht ist das der Grund, warum er noch nicht der Superstar auf der Cartoonszene ist. Die Deutschen sind möglicherweise noch nicht reif für ihn. So wird es ihm gehen, wie den Monks: erst im hohen Alter wird ihm der Stellenwert zukommen, der ihm wirklich gebührt.
Vor ein paar Jahren erschien bei DREDFOX die deutsche Übersetzung von Deke Leonards „Rhinos, Winos & Lunatics“ (Man – die Legende einer Rock-Band) (ISBN 978-3-89064-074-7, € 19,90, 351 S.). Deke Leonard kann nicht nur schreiben, er hat auch einiges erlebt mit seiner Band, die auf dem Kontinent mehr Stellenwert besaß, als im englischen Mutterland. Ich kann mich an kein bedeutendes Rockfestival der frühen bis Mitt-Siebziger erinnern, auf dem Man gefehlt hat. Einfach eine Klasseband, deren Alben ich heute noch regelmäßig auflege. Die Übersetzung von Jörg Gülden (Rolling Stone) ist gelungen, die Ausgabe an sich deutlich der englischen Orginalausgabe überlegen – schönes Bildmaterial, gutes Schriftbild, ansprechendes Cover. Wer etwas über Rockkultur aus der Perspektive eines (recht intellektuellen) Insiders erfahren will, der ist bei diesem Buch gut aufgehoben. Eigentlich ein Muss.
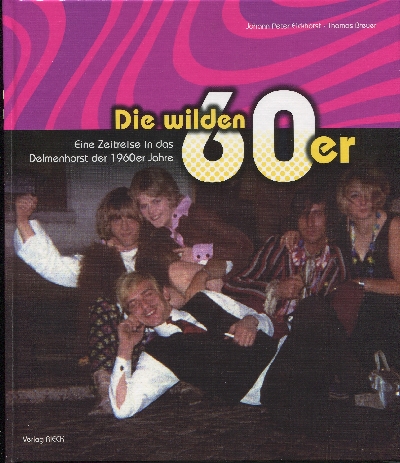 Wer ein wenig in unsere Nachbarschaft schauen möchte, dem empfehle ich das kürzlich erschienene Buch „Die wilden 60er – Eine Zeitreise in das Delmenhorst der 1960er Jahre“ von Johann Peter Eickhorst und Thomas Breuer. Nicht gerade ein genialer Titel, aber ein schönes Buch, welches sich mit dem Zeitgeist – wie in DEL damals vorzufinden – generell auseinandersetzt. Aber auch die Musiker kommen zum Zuge, und der Besuch von Brian Jones im Städtchen an der Delme wird ausreichend gewürdigt. Allein auf dem Cover hat er m.E. nichts zu suchen, aber das hatte ich nicht zu entscheiden. Ich glaube ich habe € 17,80 bezahlt. Verlag Rieck, ISBN 978-3—920794-75-3.
Wer ein wenig in unsere Nachbarschaft schauen möchte, dem empfehle ich das kürzlich erschienene Buch „Die wilden 60er – Eine Zeitreise in das Delmenhorst der 1960er Jahre“ von Johann Peter Eickhorst und Thomas Breuer. Nicht gerade ein genialer Titel, aber ein schönes Buch, welches sich mit dem Zeitgeist – wie in DEL damals vorzufinden – generell auseinandersetzt. Aber auch die Musiker kommen zum Zuge, und der Besuch von Brian Jones im Städtchen an der Delme wird ausreichend gewürdigt. Allein auf dem Cover hat er m.E. nichts zu suchen, aber das hatte ich nicht zu entscheiden. Ich glaube ich habe € 17,80 bezahlt. Verlag Rieck, ISBN 978-3—920794-75-3.
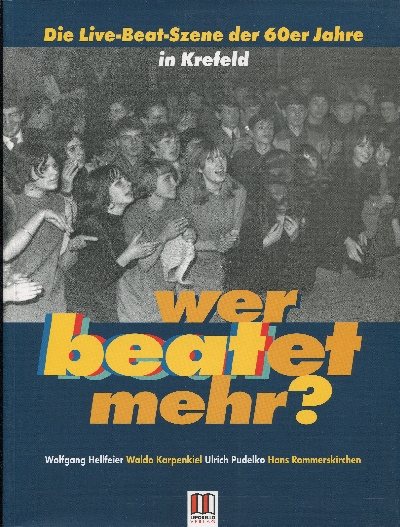
Einen stadtbezogenen Aspekt haben auch Wolfgang Hellfeier (The God of Hellfire?), Waldo Karpenkiel, Ulrich Pudelko und Hans Rommerskirchen in den Vordergrund gestellt: „wer beatet mehr ? – Die Live-Beat-Szene der 60er Jahre in Krefeld„. Gut recherchiert – und im Mittelpunkt stehen natürlich die von mir sehr geschätzte Band Die Fremden sowie die Kelty Brothers. Leporello Buch, € 18,00, ISBN 3-936783-14-4.
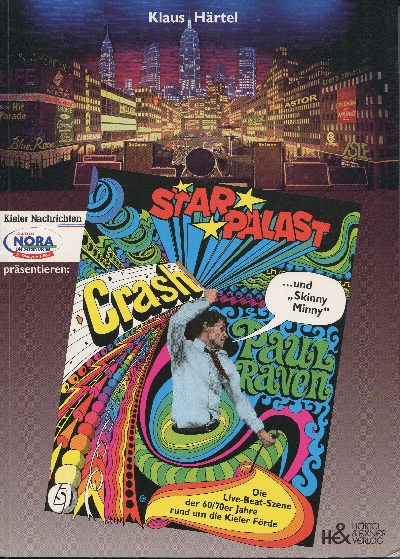 Früher hätten sich die Bands nach einem Engagement im Star-Palast gerissen, nun gibt es ein Buch zum Club – allerdings wird nur das Haupthaus in Kiel erfasst und nicht die Dependancen. Autor Klaus Härtel recherchiert genau, und so ist ein sachlich fundiertes Buch herausgekommen „Star-Palast und ‚Skinny Minny‚“. Härtel und Exner Verleg, € 39,00, ISBN 3-931476-95-2.
Früher hätten sich die Bands nach einem Engagement im Star-Palast gerissen, nun gibt es ein Buch zum Club – allerdings wird nur das Haupthaus in Kiel erfasst und nicht die Dependancen. Autor Klaus Härtel recherchiert genau, und so ist ein sachlich fundiertes Buch herausgekommen „Star-Palast und ‚Skinny Minny‚“. Härtel und Exner Verleg, € 39,00, ISBN 3-931476-95-2.
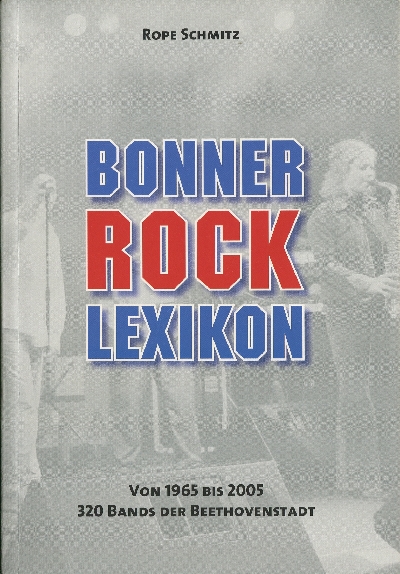
Sehr zu empfehlen für Musikfreunde, die gerne die historischen Aspekte ergründen, ist das von Rope Schmitz hervorragend gemachte „Bonner Rock Lexikon – Von 1965 bis 2005 320 Bands der Beethovenstadt„. Dort findet man nicht nur schöne Geschichten und gut recherchierte Geschichte, sondern auch interessante Querverbindungen. Erschienen im Eigenverlag und erhältlich über den Autor.
 Ein absolutes Muss ist natürlich das von Heinz Dietz und Mathias Buck erarbeitete und herausgegebene Buch „Die deutschen Beatbands„. Hier werden alle Plattencover abgebildet, die Bezug zur deutschen Beatszene haben. Jede, noch so unbekannte und kuriose deutsche Band, die eine Schallplatte hinterlassen hat, findet sich dokumentiert, wie auch jene englischen Bands, die nur in Deutschland ein Plattenstudio von innen gesehen haben. Und wenn ich hier von 216 Seiten im Großformat mit jeweils 12 Coverabbildungen pro Seite rede, dann weiß man, wie viele Spuren die deutschen Bands hinterlassen haben. In seiner Fülle und seinem Reichtum ist dieses Buch ein absoluter Schatz, ein Leben ohne dieses könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Und wetten, die Mehrzahl aller hier abgebildeten Platten sind dem Leser unbekannt!? € 24 über die Autoren.
Ein absolutes Muss ist natürlich das von Heinz Dietz und Mathias Buck erarbeitete und herausgegebene Buch „Die deutschen Beatbands„. Hier werden alle Plattencover abgebildet, die Bezug zur deutschen Beatszene haben. Jede, noch so unbekannte und kuriose deutsche Band, die eine Schallplatte hinterlassen hat, findet sich dokumentiert, wie auch jene englischen Bands, die nur in Deutschland ein Plattenstudio von innen gesehen haben. Und wenn ich hier von 216 Seiten im Großformat mit jeweils 12 Coverabbildungen pro Seite rede, dann weiß man, wie viele Spuren die deutschen Bands hinterlassen haben. In seiner Fülle und seinem Reichtum ist dieses Buch ein absoluter Schatz, ein Leben ohne dieses könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Und wetten, die Mehrzahl aller hier abgebildeten Platten sind dem Leser unbekannt!? € 24 über die Autoren.
Vor Jahren habe ich mir das 680-Seiten-Buch „Komm, gib mir deine Hand“ von Thorsten Knublauch und Axel Korinth gekauft. Es behandelt die 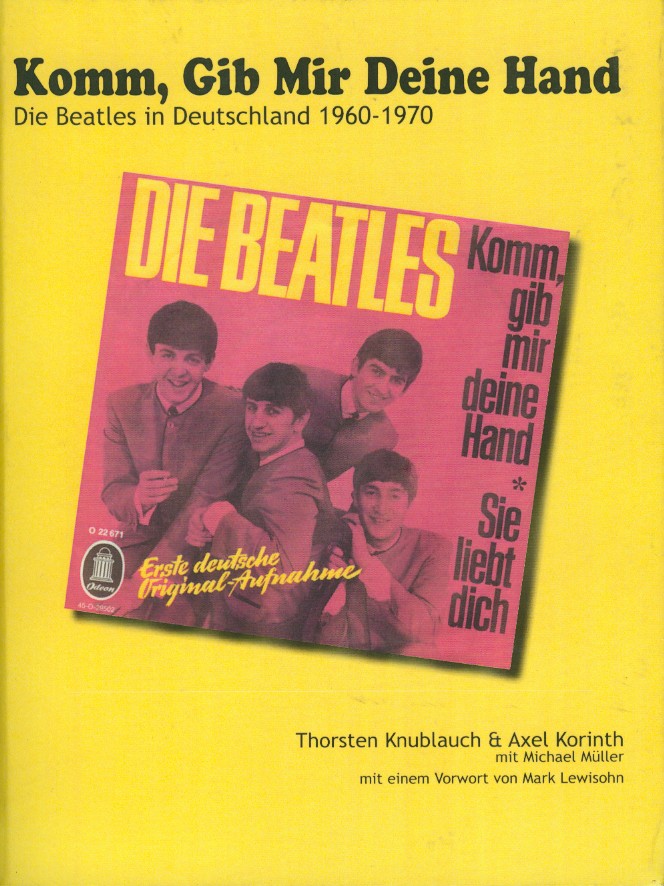 Beatles-Karriere in Deutschland, und ich muss gestehen, ich habe selten ein schlechter geschriebenes Buch in der Hand gehalten. Hier waren zwei Erbsenzähler an der Arbeit, haben jeden Stein umgedreht, um etwas zu finden, und sich dabei in einem Wirrwarr von Querverweisen à la „Wie wir im Kapitel (…) schon beschrieben haben…“, Weitschweifigkeiten und Wiederholungen verrannt. Natürlich stand keiner der Protagonisten aus der ersten Reihe für Befragungen zur Verfügung, und so wird dann alles mühsam über Dritte recherchiert. Dabei ist die Beweisführung ungelenk und umständlich. Die Sprache ist hölzern und eckig, der Wortschatz der eines Mittelstufenschülers. Zitat gefällig? „Es gibt sogar ein Foto von Jürgen und Paul, was Jürgen nicht kannte, bis wir es ihm geschickt haben. Dieses Bild und weitere findet man in neueren Auflagen des Hunter Davies Buchs. Die Fotos sind von John und Paul, aber auch von Jürgen Vollmer gemacht worden. Jürgen schrieb in einem Brief an uns wie folgt: (…)“ Diese Stelle ist willkürlich per Daumenkino ausgewählt. Ich fand es müßig, nach dem Schlimmsten zu suchen. Kurzum: dem Buch fehlt jede Dynamik und jeder Impetus, und deshalb ist es nur gleichgesinnten Erbsenzählern zu empfehlen. Ich habe mich selten mehr gelangweilt. Und wen interessiert es, ob eine Aufnahmesession um 2.00 h oder 2.15 h begann? Wäre dieser Schinken nicht schwer wie ein Amboss, würde ich es für eine Parodie halten. Aber diese Leute nehmen jeden gelassenen Furz schrecklich ernst und suhlen sich selbstbeweihräuchernd in Belanglosigkeiten.
Beatles-Karriere in Deutschland, und ich muss gestehen, ich habe selten ein schlechter geschriebenes Buch in der Hand gehalten. Hier waren zwei Erbsenzähler an der Arbeit, haben jeden Stein umgedreht, um etwas zu finden, und sich dabei in einem Wirrwarr von Querverweisen à la „Wie wir im Kapitel (…) schon beschrieben haben…“, Weitschweifigkeiten und Wiederholungen verrannt. Natürlich stand keiner der Protagonisten aus der ersten Reihe für Befragungen zur Verfügung, und so wird dann alles mühsam über Dritte recherchiert. Dabei ist die Beweisführung ungelenk und umständlich. Die Sprache ist hölzern und eckig, der Wortschatz der eines Mittelstufenschülers. Zitat gefällig? „Es gibt sogar ein Foto von Jürgen und Paul, was Jürgen nicht kannte, bis wir es ihm geschickt haben. Dieses Bild und weitere findet man in neueren Auflagen des Hunter Davies Buchs. Die Fotos sind von John und Paul, aber auch von Jürgen Vollmer gemacht worden. Jürgen schrieb in einem Brief an uns wie folgt: (…)“ Diese Stelle ist willkürlich per Daumenkino ausgewählt. Ich fand es müßig, nach dem Schlimmsten zu suchen. Kurzum: dem Buch fehlt jede Dynamik und jeder Impetus, und deshalb ist es nur gleichgesinnten Erbsenzählern zu empfehlen. Ich habe mich selten mehr gelangweilt. Und wen interessiert es, ob eine Aufnahmesession um 2.00 h oder 2.15 h begann? Wäre dieser Schinken nicht schwer wie ein Amboss, würde ich es für eine Parodie halten. Aber diese Leute nehmen jeden gelassenen Furz schrecklich ernst und suhlen sich selbstbeweihräuchernd in Belanglosigkeiten.
- Dieter Baacke prägte diesen Begriff 1970 in seinem fundierten Buch „Beat – die sprachlose Opposition“. ↩
- Die Rolling Stones kommen in diesem Buch erstaunlich selten vor! ↩
- Sind zwei Flüsse schon ein Dreieck? ↩
- Was ist mit den weiblichen? ↩
- Die Kentuckys-Story in hartbeat! 21 ist immer noch die ausführlichste. ↩
- Hahn oder Lieb, habt ihr euch jemals die LPs der Equals angehört? ↩
- In hartbeat! 11 gibt es Fotos von beiden Bands vom Konzert in Düsseldorf, einen Tag vorher ↩
